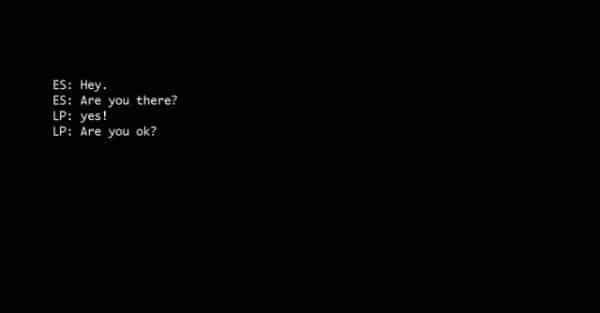In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires kann man seit einigen Jahren seine Rechnungen für Strom, Gas, Telefon oder etwa Strafzettel an Bezahlstellen namens Rapipago oder Pagofácil begleichen. Meistens funktioniert dies auch recht schnell und unkompliziert und für argentinische Verhältnisse auch recht unbürokratisch. Dennoch können manche Kunden nur schwer ihre Wut zurückhalten. Man braucht derzeit gute Nerven in Argentinien und eine feines Gespür für Zahlen: Die Geldentwertung liegt bei mehr als 30 Prozent. Im Vergleich zur argentinischen Hyperinflation der 1980er Jahre ist dies zwar eine Kleinigkeit; auch in puncto Staatsbankrott mussten die Bewohner des Landes bereits eine gewisse Routine sammeln – doch vielen reicht es jetzt.
Die linkspopulistische Landesregierung hat genauso wie neoliberale Provinzregierungen sehr angenehme aber unhaltbare Subventionen zurückgefahren oder eingestellt. Die Folge: Strom- und Gasrechnungen stiegen 2014 auch für Normalhaushalte gleich um mehrere hundert Prozent, auch die Preise für die öffentlichen Verkehrsmittel wurden abrupt drastisch erhöht. Die Maßnahmen wurden von den Verantwortlichen nicht kommuniziert, die hohe Inflation wird im Regierungsdiskurs immer noch verleugnet. Stattdessen schmähen sich Regierung und Opposition, die teilweise aus derselben Partei stammen, ¬gegenseitig und sind auf Konfrontationskurs. Kompromisse werden nicht geschlossen.
In ihrer klugen Doktorarbeit hat die Soziologin Maristella Svampa die Geschichte des Landes vom 19. Jahrhundert bis heute analysiert und ständig auftretende und scheinbar unüberbrückbare Spannungen in der argentinischen Gesellschaft erkannt, die sie als das zentrale Dilemma des Landes bezeichnet. Sie greift auf eine griffige Formel zurück, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts von dem Schriftsteller, Journalisten und späteren Präsidenten Domingo Faustino Sarmiento geprägt wurde und fasst die leitmotivisch auftauchenden Spannungen, die Argentinien prägen, unter der Dichotomie „Zivilisation vs. Barbarei“ zusammen.
Doch wer sind die ‚Zivilisierten’? Wer sind die ‚Barbaren’?
Man bekommt den Eindruck, dass jeder Porteño – so werden die Bewohner von Buenos Aires genannt – jederzeit zum ‚Barbaren’ werden kann. „Ich mache es wie Bombita“, hört man seit einigen Monaten häufiger in den Straßen von Buenos Aires. In den sozialen Netzwerken taucht immer wieder der Eintrag „#TodosSomosBombita“ – „Wir sind alle Bombita“ auf.
„Bombita“ ist eine Figur aus Damián Szifróns „Wild Tales – Relatos Salvajes“. Es handelt sich um den Sprengstoffexperten Simón, der einen ausgesprochen schlechten Tag hat. Weil sein Auto scheinbar ohne Grund abgeschleppt wird, verpasst er den Geburtstag seiner Tochter. Sein Kind ist beleidigt, seine Frau hält die Entschuldigungen ihres Mannes für so fadenscheinig und erlogen, wie so viele andere Ausreden, die sie in den gemeinsamen Ehejahren schon schlucken musste, und zieht die Konsequenz. Sie reicht die Scheidung ein. Simón geht am nächsten Tag zu einem besagten Rapipago und macht einen städtischen Mitarbeiter für sein persönliches Unglück verantwortlich. Als er kein Verständnis erfährt und auch noch ein hohes Bußgeld für sein abgeschlepptes Auto zahlen muss, brennen bei ihm die Sicherungen durch. Mit Gewalt setzt er sich gegen vermeintliche bürokratische Willkür zur Wehr. Dies löst eine Kettenreaktion aus, an deren Ende Simón seinen Job verloren hat und finanziell ruiniert ist. Daraufhin schmiedet er einen Racheplan und setzt seine Gewaltphantasien, die derzeit sehr viele Argentinier latent haben, in die Tat um. Damit wird er wieder zum Gewinner.
Er wird als „Bombita“, der „kleine Bomber“ berühmt. Auch seine Frau und seine Tochter versöhnen sich wieder mit ihm. Selbst Vertreter staatlicher Institutionen zeigen ihm Respekt.
Er war ein Opfer, das keineswegs unschuldig an seiner Situation war – und wird durch Gewalttaten zum Helden.
Die Handlung um „Bombita“ ist nur eine Geschichte des Films. Insgesamt sechs „Wild Tales“, die weder inhaltlich noch personell miteinander verknüpft sind, bilden den Episodenfilm: Sechs Miniaturen, jede in einem leicht anderen Tonfall, in denen es um Gewalt, Mord und Totschlag durch Normalbürger als Folge einer Kettenreaktion und/oder ausgelebte Rache geht.
Alle wichtigen Themenkomplexe, die im zeitgenössischen argentinischen Kino verarbeitet werden, sind in Damián Szifróns Film zu finden: der Stadt-Land-Gegensatz; Korruption; die besonders in Buenos Aires gefühlt hohe Kriminalitätsrate, wie auch die Folgen einer wilden neoliberalen Politik in den 1990er Jahren, die in den Staatsbankrott 2001/2002 mündete. In dessen Folge wurden gleich mehrere Präsidenten innerhalb nur weniger Tage von hunderttausenden Demonstranten aus dem Amt gejagt. „Que se vayan todos!“ – „Sie sollen alle verschwinden“ – war der Schlachtruf der wütenden Menge. Gemeint war eine Politikerkaste, die nur in die eigene Tasche gewirtschaftet und sich vom Volk entfernt hatte.
„Que se vayan todos!“ bildet auch das Grundthema der „Bombita“-Geschichte, die als bissiger Kommentar zu der amtierenden Regierung um die Präsidentin Cristina Kirchner zu deuten ist. Cristina Kirchner und ihr Amtsvorgänger, ihr mittlerweile verstorbener Ehemann Néstor Kirchner, gehören einer Generation an, die sich seit dem Ende der 1960er Jahre politisch engagierte, um das Land umzugestalten. Das Ergebnis sollte ein sozialistisches, gerechteres Argentinien sein. Viele Aktivisten wollten aber nicht den Weg durch die Institutionen gehen, sondern schlossen sich einer Guerilla an, die das Land an den Rande des Bürgerkriegs brachte und sich letztlich mitverantwortlich für den Militärputsch 1976 zeichnete, in dessen Folge, tausende Menschen – egal ob sie zuvor politisch aktiv waren oder nicht – inhaftiert, gefoltert und getötet wurden. Viele der Opfer sind „desaparecidos“, „Verschwundene“, deren Überreste niemals gefunden werden, weil sie von den Militärs im Atlantik versenkt wurden.
Die Kirchners, die seit 2003 regieren, hatten sich das Ziel gesetzt, das „politische Projekt“ ihrer Generation zu Ende zu führen und mit einer paternalistischen und populistischen linken Politik das Land gerechter zu machen.
Die Regierung verschweigt nicht die Mitschuld dieser Generation an den Entwicklungen des Landes in den 1970er Jahren. Opfer, darunter viele Guerillamitglieder, die sich für Bombenanschläge und Entführungen verantwortlich zeichneten, Angehörige von „Verschwundenen“ und Aktivisten, die diese Zeit überlebt haben, wurden von ihr statt dessen zu Helden erklärt.
Die Politik der Regierung Kirchner polarisiert das Land. Zu groß sind die Parallelen, um nicht eine zwar wenig subtile, aber dennoch unaufdringliche Anspielung daran in „Wild Tales' zu erkennen.
Die Kritik an der Regierung ist ein Grund für den grandiosen Erfolg von Damián Szifróns Film, sonst wäre nicht eine Figur wie „Bombita“ schon sprichwörtlich geworden.
Seit August läuft er in den argentinischen Kinos. Bis heute sahen 3,5 Millionen Menschen in dem 40 Millionen-Einwohnerland „Wild Tales'. Mehr Zuschauer hatten nur zwei Produktionen in der nationalen Filmgeschichte. Produktionen mit ähnlich hohen Zuschauerzahlen waren ebenso politische Filme und bildeten ebenso bissige Kommentare zu den politisch, sozial und kulturellen Kontexten ihrer Entstehungszeit – zu nennen sei etwa „La Patagonia Reblede' von Héctor Olivera, („Das rebellische Patagonien', 1974) oder als jüngstes Beispiel der Oscar-Gewinner „El secreto de sus ojos' („Das Geheimnis ihrer Augen', 2009) von Juan José Campanella. „Wild Tales – Relatos Salvajes' reiht sich also in eine Tradition ein.
Die Kritik am Politikbetrieb ist aber nicht das einzige Geheimnis des Erfolges von „Wild Tales': Zunächst einmal öffnete der Name des Co-Produzenten Pedro Almodóvar einige Türen. Zwar garantiert der Name Almodóvar (ebensowenig wie in Deutschland) in Lateinamerika kaum noch ein großes Publikum. Der spanische Regisseur hat scheinbar seinen kreativen Höhepunkt schon überschritten, es dürfte aber sein Name oder sein Einfluss gewesen sein, der „Wild Tales' den Weg zu einigen bedeutenden Festivals sicherte. Denn der Name Damián Szifrón war zuvor nur wenigen Eingehweihten ein Begriff. Der 1975 geborene Regisseur hatte zwar mit „El fondo del mar' (2003) und „Tiempo de valientes' (2005) zwei Kinofilme vorgelegt, die national für Aufsehen gesorgt hatten, in den letzten zehn Jahren war er aber eher als Regisseur und Produzent von Fernseherien tätig.
Grade die positiven Publikums- und Kritikerreaktionen beim Filmfestival von Cannes sorgten für eine Kettenreaktion, die beim argentinischen Kinopublikum ein immer größeres Interesse an dem Film generierte.
Der zweite Grund für den Erfolg ist das hervorragende Schauspielerensemble. Ricardo Darín als „Bombita“ Simón ist der einzige Superstar des argentinischen Kinos. Die Präsenz des ehemaligen Soap-Stars in einem Film ist in Argentinien schon ein Garant für hohe Zuschauerzahlen. Darín steht aber auch für Qualität. Er war Hauptdarsteller in einigen der herausragenden Produktionen der jüngeren Geschichte des argentinischen Kinos. Man könnte etwa die Filme „Nueve Reinas' (2001) und „El Aura' (2006) von dem mittlerweile verstorbenen Fabián Bielinsky nennen oder etwa auch den bereits erwähnten Oscar-Gewinner „El secreto de sus ojos'.
Julieta Zylberberg, die Kellnerin eines Restaurants in der Episode „Die Ratten“, die an einem verregnetem Abend in ihrem einzigen Kunden ausgerechnet den Kredithai erkennt, der ihren Vater in den Selbstmord trieb und vor der resoluten Köchin der Gaststätte laut überlegt, ob sie ihre lange Jahre gehegten Rachepläne tatsächlich in die Tat umsetzen solle, ist mittlerweile in ebenso vielen wie hochklassigen Produktionen zu sehen, wie Ricardo Darín – etwa in „La niña santa' („Das heilige Kind', 2004) von Lucrecia Martel, der ebenfalls von den Brüdern Almodóvar produziert wurde, in „La mirada invisible' („Der unsichtbare Blick', 2010) von Diego Lerman oder in dem Fußballerfilm „El 5 de Talleres' von Adrián Biniéz („Die Nr. 5 von ‚Talleres’', 2014), der in Kürze auch in Deutschland in den Kinos laufen wird.
Andere herausragende Schauspieler, die mehr oder weniger lange Auftritte in „Wild Tales' haben, sind Osmar Nuñez oder Erica Rivas.
Erica Rivas, die auch zu den bekanntesten Theaterschauspielern des Landes zählt (und derzeit mit Ricardo Darín mit der Bergman-Adaption „Szenen einer Ehe' auf Tour geht), spielt in dem Segment „Bis dass der Tod euch scheidet“ eine Braut, die noch während der Hochzeitsfeier, die Untreue ihres Mannes entdeckt. Wieder löst eine Racheaktion eine Kettenreaktion aus, und die Hochzeitsfeier gerät aus dem Ruder. Man fühlt sich zeitweise an Danny de Vitos „Der Rosenkrieg' (1989) erinnert. Wie bei der schwarzen Komödie um ein Ehepaar (gespielt von Michael Douglas und Kathleen Turner), das einen makabren Ehekrieg führt, gibt es witzige Momente, doch ist „Bis dass der Tod euch scheidet“ zeitweise so grausam, dass man kaum lachen kann. Das vermeintliche Happy End hinterlässt dann auch eher gemischte Gefühle.
Immer wieder gibt es in „Wild Tales' Momente, die den cinephilen Zuschauer an andere Regisseure und an andere Filme erinnern. Referenzpunkte sind Italowestern, natürlich verschiedene Werke von Pedro Almodóvar (aus den aus den 1980er und frühen 1990er Jahren), von Quentin Tarantino (speziell dessen Beitrag zum Episodenfilm „Four Rooms' (1995)), Martin Scorseses „Taxi Driver' (1976), Filme von den Coen-Brüdern, von dem Italiener Dino Risi oder von dem Spanier Alex de la Iglesia.
Auch im argentinischen Kino findet Damián Szifrón seine Vorbilder. Zu nennen sei hier etwa Adolfo Aristarains „Tiempo de revancha' („Zeit der Rache') aus dem Jahr 1981.
Dies ist Teil der Erfolgsformel von „Wild Tales'. Elemente aus der Tradition des nationalen Kinos werden mit Elementen des internationalen Independent- und Genrekinos verbunden. Scheinbar ist eine richtige Mischung aus diesen Elementen eine Art Erfolgsformel. In Mexiko und über die Landesgrenzen hinaus ließ ein solcher Mix etwa Alejandro González Iñárritus „Amores perros' (2000) zu einem Blockbuster werden. In Brasilien war dies bei Fernando Meirelles und Kátia Lunds „City of God' (2002) der Fall. In Argentinien fand Fabián Bielinsky (1959-2006) in seinem schmalen Oeuvre (darunter „Nueve Reinas') das richtige Rezept, ebenso wie Juan José Campanella in „El hijo de la novia' („Der Sohn der Braut', 2001) oder in „El secreto de sus ojos'.
Es wird spannend sein zu beobachten, ob Szifrón auch in Zukunft so ein glückliches Händchen haben wird. Es ist zu vernehmen, dass er an einer Reihe von Projekten arbeitet – darunter an einer Science-Fiction- Geschichte, sowie an einem Western; einem Genre, das in Argentinien derzeit so etwas wie eine Renaissance erlebt.
Das Fachblatt Variety erklärte jetzt schon Szifróns Film zu einem der Highlights des Jahres.
Tatsächlich ist „Wild Tales' ist ein unterhaltsamer, aber kein großer Film. Bei einem Episodenfilm gibt es immer stärkere und schwächere Segmente. Letztlich wirkt das Gesamtwerk wie eine Ansammlung von Sketchen, in denen Slapstick mit Gesellschaftskritik gepaart ist. Die Anarchie der Situationskomik erschöpft sich allerdings spätestens nach der vierten Episode und es ist voraussehbar, was passieren wird. Die Handlung muss in diesen Miniaturen schnell vorangetrieben werden, deswegen wirken die Dialoge mitunter künstlich und aufgesetzt.
Am Ende steht die Frage, ob „Wild Tales' auch außerhalb Argentiniens erfolgreich sein wird. Auch wenn nicht alle politischen Anspielungen beim internationalen Publikum ankommen, der schwarze Humor des Films ist universell verständlich. Dies zeigten die Zuschauerreaktionen etwa auf den Festivals in Cannes und in San Sebastián. Zudem gibt es, salopp gesagt, in jedem Land Wutbürger, die mit den Protagonisten mitfühlen können.
Aber dennoch wird der Zuschauer mit dem Gefühl aus dem Kino gehen, dass etwas faul im Staate Argentinien sei. Der Film erweckt den Eindruck eines Panoramablicks auf eine Gesellschaft, die aus den Fugen geraten ist.