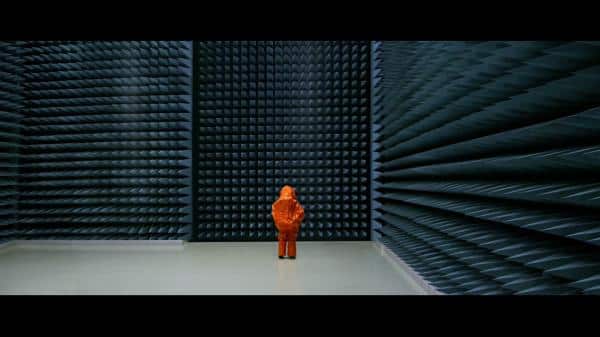Eine These von mir zu Literaturverfilmungen lautet, dass es zwar einfach ist aus Büchern, die wahrscheinlich aus Gründen kein Mensch kennt, große Film zu machen, aber ziemlich schwer, große Literatur angemessen zu verfilmen. Ein Autor, mit dem sich der letzte Teil dieser These zur Genüge belegen lässt, ist Stephen King. Nach „The Running Man“ ist „Children of the Corn“ schon die zweite Adaption eines Werkes von ihm, die ich in relativ kurzer Zeit gesehen habe, die als regelrechter Verrat am zugrunde liegenden literarischen Text, an dessen düsterem Welt- und Menschenbild angesehen werden muss.
Kings frühe Erzählung bietet eine Schreckensvision des gerade im Bible Belt grassierenden christlichen Fundamentalismus. Erzählt wird von dem Ehepaar Vicky und Burt Robeson, das sich im ländlichen Nebraska hoffnungslos verfährt und so in dem Städtchen Gatlin landet, dessen Kinder sich zu einer mörderischen Sekte zusammengeschlossen haben, die alle Erwachsenen des Ortes umgebracht hat und jeden Menschen an seinem oder ihren 19. Geburtstag Gott opfert, der in ihrer Version „He Who Walks Behind the Rows“ heißt, wobei sich eine denkbar bigotte christliche Vorstellung des Big Boss mit heidnischen Motiven vermengt (in den Filmen ist dieser Gott eine Art in den Maisfeldern lebender Dämon).
Die Eheleute sind in der Kurzgeschichte hoffnungslos zerstritten, und das Grauen, in dem sie sich bald gefangen finden, bildet eine Art Zuspitzung ihrer Lebenssituation, ein nach außen projiziertes Abbild ihres Konfliktes, und die Kinder, die die beiden nie hatten, kommen nun als tödliche Bedrohung über sie. Während für Vicky, der eine fundamentalistisch christliche Erziehung auf dem Land zuteil wurde, in den Kindern einen Albdruck ihrer uralten Ängste sieht, sie der Zorn eines strafenden Gottes, vor dem sie wohl ein Leben lang floh, doch noch ereilt, wenn sie schließlich als verstümmelte Leiche an einem Kreuz endet, sieht Burt zumindest für einen kurzen Augenblick das Opfer seiner Frau als Ausweg aus der Hölle, die seine Ehe geworden ist.
In der Verfilmung des Stoffes von Fritz Kiersch bleibt von der derart grimmig aufgelösten Ehekrise schon deshalb nichts übrig, weil es sie hier gar nicht gibt. Vicky und Burt, der im Film ein junger Arzt ist, sind jung und glücklich verliebt, er kann sie gegen Ende nicht nur retten, sondern auch noch die Kinder belehren, dass ihr Handeln falsch ist, den Dämon, der hier wesentlich weiter ausbuchstabiert wird, durch Feuer besiegen – und wo am Ende der Erzählung nur noch die bösen Kinder bleiben, während die frustrierten Erwachsenen von ihren Sorgen auf immer befreit sind, gibt es im Film ein Happy End mit Familie. Das Ehepaar nimmt zwei der Kinder, die nicht dem kollektiven Wahn verfallen sind und unter dem Diktat der anderen zu leiden hatten, vorläufig zu sich auf.
Es ist eines der Rätsel der Filmgeschichte, dass gerade diese familienfreundliche Verwässerung einer düster nihilistischen Kurzgeschichte sich als so erfolgreich erwies, dass sie zum Begründer einer bislang acht Teile und ein Remake zählenden Reihe wurde. Es hat aber auch sein Gutes, weil die Sequels, ohne den literarischen Text weiter zu pervertieren, wesentlich freier gestaltet werden konnten, was man den meisten von ihnen denn zum Glück auch anmerkt.
* * *
„Children of the Corn II: The Final Sacrifice“ („Kinder des Zorns 2: Tödliche Ernte“, 1992)
So ist die erste Fortsetzung nicht nur der klar bessere Film, sondern auch tatsächlich näher am Geist der Kurzgeschichte, mit der er der Handlung nach überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wie dort geht es auch hier um eine zerrüttete Familie, wobei der Fokus nun aber auf einem Vater-Sohn-Konflikt liegt. Der Journalist John kommt nach Nebraska, um eine Reportage über die Ereignisse in Gatlin zu verfassen. Mit dabei hat er seinen jugendlichen Sohn Danny, der bei der Mutter aufgewachsen ist, seinen Vater bislang nicht kannte und nun trotzig und ungehalten auf dessen späte Annäherung reagiert. Die Kinder von einst, die in Hemmingford, einem Nachbarort von Gatlin, von den Erwachsenen adoptiert wurden, beginnen bald ihr mörderisches Treiben wieder aufzunehmen. In dem, was ihr Anführer Mica Danny über die Heuchelei seines bigott religiösen Vaters erzählt, findet dieser das Verhalten seines eigenen Vaters gespiegelt. Das Morden an den Eltern wird so ödipal aufgeladen.
Der Film verfügt über einige denkbar delirante Splattereinlagen. Etwa wenn in einer Messe eines der Kinder, das in der hintersten Reihe sitzt, mit einer Holzpuppe, an deren Gesicht er sich mit einem Messer zu schaffen macht, mit einer Art Voodoo-Zauber einen Mann, der ganz vorne sitzt, tötet. Während der Prediger Gewalt und Sex im Film verurteilt, blutet der Mann zunächst aus Nase und Ohren, dann aus dem Mund bis von seinem Gesicht schließlich nur noch blutiger Matsch übrig ist. Eine ältere Frau im automatischen Rollstuhl, die von Anfang an das Böse in den Kindern sieht, wird per Fernbedienung von diesen auf die Straße gesteuert, wo sie ein LKW erfasst und durch die Scheibe eines Lokals schleudert, in dem gerade Bingo gespielt wird. Als das Fenster klirrt geht ein Mann zu Boden, der gerade verheißungsvoll auf seine Karte geguckt hatte und nach dem Crash nun stolz verkünden kann: „Bingo!“ Denkwürdig ist weiterhin ein Mord an einem Mann, bei dem die Kinder eine Vielzahl von Spritzen als Folterinstrumente verwenden, bevor es zum Todesstoß mit der Sichel kommt.
John bekommt als Sidekick einen indianischen Universitätsprofessor, mit dem der Film denkbar bescheuert spiritualistisch endet, und in einem Seitenerzählstrang gibt es eine Verschwörung um hochgiftigen Dünger.
* * *
„Children of the Corn III: Urban Harvest“ („Kinder des Zorns 3: Das Chicago-Massaker“)
Der kleine Eli und sein Teenagebruder Joshua kommen aus Nebraska nach Chicago zu neuen Adoptiveltern. Die Mutter merkt schnell, dass mit Eli etwas nicht stimmt. Der wortgewandte Junge beginnt schnell, seine MitschülerInnen um sich zu scharen, die mehr und mehr besessen werden von „He Who Walks Behind the Rows.“ Die Show und das Erwachsenenmorden können beginnen.
Der dritte Teil bringt unter anderem einen Race-Aspekt ins Franchise mit ein, was auch der Vorgänger durch die Indianerfigur tat, aber, wie Vern feststellt: „The word „Urban“ is marketing code for „black.“ Schwarz ist der Bully der Klasse, der vermeintlich in Eli und Joshua einfache Opfer findet, schwarz ist aber auch ein Mitschüler Malcom, mit dem sich Josh bald anfreundet und dessen Schwester Maria zu seinem love interest wird. Merke: Gut und Böse kann man nicht an der Hautfarbe erkennen, und Josh imponiert Malcom zunächst dadurch, dass er ein begnadeter Basketballer ist. Merke: white man CAN jump. Und die Elis Predigten verfallende Masse ist sowieso bunt gemischt. Darüber hinaus ist der Adoptivvater der Beiden ein gewiefter Geschäftsmann, der im Mais, der den Tod bedeutet, vor allem ein big business sieht, und im Epilog verirrt sich eine Kiste mit ein paar Kolben des Super-Mais an den Hamburger Hafen, wo sie wiederum von eifrigen Kapitalisten in Empfang genommen wird (ein Cliffhanger, den der vierte Teil dann natürlich geflissentlich ignoriert).
Auch an Splatter hat dieser Teil einiges zu bieten. Etwa wenn Malcom den Kopf verliert, der aber doch über die Wirbelsäule mit dem Rest des Körpers in Verbindung bleibt. Die creature effects des Dämons, der hier erstmals eine physischere Form bekommt, stammen von Screaming Mad George, der auch an den Spezialeffekten zu vielen Filmen von Brian Yuzna arbeitete und auch hier zeigt, dass er sich auf sein schleimiges Handwerk versteht. Wenn Josh Maria aus den Innereien des Dämons frei schneidet, geht das so blutig zu, dass sich Assoziationen zu „Braindead“ auftun (und natürlich zollen die mit ihren Schlingen zupackenden Maispflanzen in diesem und folgenden Teilen auch Sam Raimis „The Evil Dead“ Tribut).
Ich liebe Filme wie diesen und den Vorgänger, nicht obwohl, sondern gerade weil sie als so krude Gemischtwarenläden daherkommen, die verschiedenste Motive aus dem Genre – und der (Populär-)Kultur überhaupt – vermengen: Voodoo, Schamanismus, Satanismus, christlicher Fundamentalismus, Kapitalismuskritik, Umweltzerstörung? You name it! We got it! Und sich darüber hinaus einen Dreck um Genregrenzen scheren, in denen das bizarr Komische und der Splatterexzess nicht nur nebeneinander stehen, sondern sich mitunter in ein und derselben Szene begegnen, ohne dass sich die Filme deshalb wirklich zu einer Horrorkomödie entwickeln würden.
* * *
„Children of the Corn: The Gathering“ („Kinder des Zorns IV – Mörderischer Kult“, 1996)
Der vierte Teil schlägt im Gegensatz zu den unmittelbaren Vorgängern (mit Teil 1 hat das ja zum Glück alles eh nur noch rudimentär zu tun) wieder einen vollkommen anderen Weg ein. Statt des absoluten Exzess mit abstrus komödiantischen Anleihen gibt es hier nun reinen Psychohorror, was schon durch das Setting in einer psychiatrischen Klinik für Kinder gesetzt wird, in der keine geringere als die sehr junge Naomi Watts als Krankenschwester arbeitet. Also gibt es sehr viele Albtraumszenen, aus der Watts und die anderen Figuren aufschrecken (Unbewusstes und so).
Der Versuch, den Exzess der Vorgänger durch geradlinigeres Spannungskino zu ersetzen, ist schon an sich wohl keine sehr gute Idee. Der Film liefert dann aber dazu noch nicht wirklich viel an Spannung und düsterer Atmosphäre. Die Kills sind recht garstig gehalten, wobei man bei der Umsetzung manchmal doch etwas sparsam mit dem Kunstblut umgegangen ist. Alles in allem ist „The Gathering“ sicherlich der „seriöseste“ Eintrag ins Franchise bislang (seriös war ja schon der Familienquatsch des Erstlings nicht, Teil 2 und 3 waren für eine solches Attribut sicherlich eh viel zu sehr over the top), was ihn leider auch zum langweiligsten macht.
* * *
„Children of the Corn V: Field of Screams“ („Kinder des Zorns V – Feld des Terrors“, 1998)
Nach dem sehr ernüchternden vierten Teil nimmt das Franchise mit der folgenden Fortsetzung wieder richtig Fahrt auf. Das geht schon mit den ersten Einstellungen los: Die Kamera bahnt sich ihren Weg durch das Maisfeld, langsam, bedrohlich. Per Überblende kommen ein paar Rosen ins Bild, deren volles Rot das Grün der Pflanzen kontrastiert. Eine Hand ergreift eine der Blüten, reißt diese mit der ganzen Rose aus und reckt sie gen Himmel. So beginnt ein Film, den man gerne Szene für Szene, bisweilen sogar Einstellung für Einstellung analysieren möchte. Dafür ist hier sicherlich kein Platz, aber der restliche Film hält, was diese ersten Bilder versprechen: einen fortwährenden Exzess, der nicht einfach den der Teile Zwei und Drei kopiert, sondern eigene Akzente setzt.
Wenig später blickt ein Kind, Ezekiel, gebannt in ein Feuer im Feld, aus dem eine Art herzig animierter Blitz in seine Brust fährt und ihn zu Boden wirft. So geht das weiter. Mit kruden Spezialeffekten und verwinkelten Kameraperspektiven. Nach dem ersten Teil gibt es hier wieder die klassische Backwood-Konstellation: Ein paar durchfahrende Teenies aus der Stadt (unter ihnen die noch vollkommen unbekannte Eva Mendez) bekommen es mit den Kindern zu tun, die „He Who Walks Behind the Rows“ anbeten, und deren fundamentalistisch christliche Ideologie von den reinen Kindern und sündigen Erwachsenen hier besonders ausführlich ausgebreitet wird. Hübsch durchgeknallt kommen die bescheuerten Teens daher, von denen ein Pärchen in einem Auto vorfährt und Sexpuppen als Wegweiser für ihre in einem anderen Auto nachkommenden Freunde an den Straßenlaternen befestigt.
Den Kindern steht hier zunächst ein David Carradine vor, was mit der schon erwähnten Mendez, die hier ihre erste Filmrolle gab, und Fred Williamson als Sheriff eine durchaus prominente Besetzung für den fünften Teil einer niedrig budgetierten Horrorreihe ergibt. Carraddine und Williamson haben einen gemeinsamen, effektiv blutigen Abgang. In der letzten Szene wird ein Kinderlied wahrlich creepy: „Hush little baby don’t say a word…“ Und in den Augen des Babys leuchtet in der letzten Einstellung das Feuer, das schon zu Beginn in Kinderaugen leuchtete. Buch und Regie stammen von Ethan Wiley, und dieser Film macht durchaus neugierig, ob es in seiner sehr überschaubaren Filmographie noch mehr Kleinode zu entdecken gibt.
(Wie den vierten und sechsten Teil gibt es auch diesen in Deutschland momentan nur auf DVDs, die völlig unzeitgemäßerweise keinen Originalton an Bord haben. Die Synchro macht aus „He Who Walks Behind the Rows“ „Er, der immer im Hintergrund steht“, und bei dem oft erwähnten „Kornfeld“ handelt es sich wohl auch eher um ein „Maisfeld“. Aber was will man in einem Franchise, das aus „Children of the Corn“ „Kinder des Zorns“ macht, schon erwarten? Ein Zornfeld vielleicht?)
* * *
„Children of the Corn 666: Isaac’s Return“ („Kinder des Zorns 6 – Isaacs Return“, 1999)
Der sechste Teil zeigt, dass auch ein ernsterer „Children of the Corn“-Film durchaus seine Berechtigung haben kann. Im Gegensatz zu den Vorgängern knüpft dieser Film an die Ereignisse des ersten Teils an. Hannah, das erste Kind, das aus dem Kult der Kinder des Mais geboren wurde, kehrt nach Gatlin zurück, um ihre echte Mutter zu finden. Hier stellt sich heraus, dass Issac, der Anführer der Kinder im ersten Teil, nicht von „He Who Walks Behind the Rows“ zu sich genommen wurde, sondern im Koma liegt, aus dem er nun erwacht, um die ursprüngliche Prophezeiung wahr werden zu lassen. Es beginnen neue Morde und die sehr weltlichen Machtkämpfe um die Auslegung des göttlichen Willens.
Der Film bietet vor allem in einer Vision Hannahs relativ zu Beginn, aber auch immer wieder später waschechtes Terrorkino. Dazu kommt auch hier wieder eine schöne Besetzung, zu der neben der seit den De Palma-Filmen der späten Siebziger und frühen Achtziger, vor allem aber seit „Robocop“ immer wieder gern gesehenen Nancy Allen auch Stacy Keach als Arzt (Keach, so verrät die IMDb, ist auch ein großer Bühnen- und vor allem Shakespeare-Darsteller gewesen, was ihn natürlich für einen Auftritt in Genre-Krachern wie diesem oder Mark L. Lesters „Class of 1999“ gereadezu prädestiniert hat).
Zum stimmigen Gesamteindruck kommt noch eine tolle Sexszene zwischen Hannah und ihrem love interest, die mit einer wechselseitigen Dusche unterm Wasserschlauch in der Scheune beginnt, und sich mit vielen Überblenden ihrer eng umschlungenen Körper fortsetzt. Lediglich das Ende ist etwas seltsam ausgefallen, was dem positiven Gesamteindruck jedoch keinen Abbruch tut.
* * *
„Children of the Corn: Revelation“ („Kinder des Zorns 7 – Revelation“, 2001)
Die Offenbarung, die der Titel verheißt, bietet dieser Film mitnichten. Die Geschichte um eine junge Frau, die aus Kalifornien auf der Suche nach ihrer Großmutter nach Nebraska kommt, und der die Kinder des Ortes sehr schnell unheimlich werden, läuft sich ziemlich schnell tot. Der Film versucht den Terror des unmittelbaren Vorgängers mit etwas comic relief – einen dauerbekifften, bongrauchenderweise die Tür öffnenden Nachbarn, Kindern am Splatterspielautomaten (die beste Szene!) – zu kombinieren. Leider zündet das nicht wirklich – trotz Michael Ironside als vernarbtem Priester und erheblichem pyrotechnischen Aufwand im Finale.
* * *
„Children of the Corn: Genesis“ (Kinder des Zorns: Genesis – Der Anfang“, 2011)
Die Reihe endet mit einem Knall(er). Wo der siebte Teil wieder einmal das Gefühl aufkommen ließ, dass sich die Reihe langsam aber sicher in halbgaren Wiederholungen des ewig Gleichen totlaufen würde, belehrt einen der erst nach zehn Jahren nachgereichte „Genesis“ gleich mit der pre title sequence eines Besseren. Diese spielt im Jahr 1973 in der Nähe von Gatlin und zeigt einen Soldaten, der nachhause kommt, nur um seine Familie gemeuchelt vorzufinden, wobei der Tatort mit den üblichen Relikten aus getrocknetem Mais versehen ist. Als ein Mädchen im Haus seiner Familie bedrohlich auf den Soldaten zukommt und er seine Pistole auf sie richtet, wird er als Babykiller bezeichnet. Zudem hat er Flashbacks auf ein blutüberströmtes vietnamesisches Kind und die Schreie seines Vorgesetzten „get a grip on yourself, soldier“. Das Morden der Kinder bekommt damit eine politisch historische Dimension, die sich auf den Krieg in Vietnam bezieht, es wird zur Rache für das Blutvergießen, dem Kinder ausgesetzt sind, was von Ferne her an Narcisco Ibáñez Serradors Meisterwerk „Ein Kind zu töten…“ erinnert. Nebenbei bemerkt ist das Geschehen im September 1973 verortet, was (ob gewollt oder auch nicht) an den Tag erinnert, als sich die Faschisten in Chile mit Rückendeckung durch die CIA an die Macht putschten.
Im Folgenden hat ein junges Ehepaar eine Autopanne im ländlichen Kalifornien, findet Unterschlupf in einem Haus, in dem es nicht mit rechten Dingen zuzugehen scheint – und bekommt es – wer hätte es geahnt? – mit „He Who Walks Behind the Rows“ und seiner infantilen Gefolgschaft zu tun. Das Paar, das die beiden aufnimmt, besteht aus einem von Billy Drago großartig gespielten Prediger und seiner ukrainischen Frau, die dem jungen Gast bald sehr eindeutige Avancen macht. Der Horror wird hier sehr geschickt auf die Spannungen zwischen dem Paar projiziert. An einer selbstreflexiven Stelle sucht sie Erklärungen aus der Populärkultur (oder genauer: dem Horrorfilm) für ihre vertrackte Lage.
Zuerst dachte ich, dass es eine fragwürdige Entscheidung des Films war, auf diesen Prolog später nicht mehr zurückzukommen, aber erst im Nachklang wird mir klar, wie sehr der Film mit diesen wenigen Minuten nicht nur den auf sie folgenden Film, sondern gar die ganze Serie in ein neues Licht taucht. Die Gewalt der Kinder ist hier nicht mehr ein Zerrbild christlichen Fundamentalismus, sondern tatsächlich die Rache eines zornigen Gottes für die Gräueln an den Schwächsten seiner Schöpfung.
Nachdem der dritte Teil schon vor einiger Zeit vom Index gestrichen wurde, ist er nun von der FSK neu geprüft worden und liegt seit dem 19. 05. bei Capelight auf einer recht schmucklosen Blu-ray vor. Eine Gesamtbox der Reihe (vornehmlich natürlich in HD) wäre schon aufgrund der unterirdischen DVDs der Teile 4-6 sehr wünschenswert, ist aber aufgrund der Inhaberschaft der Rechte wohl sehr unwahrscheinlich.
(Eine Besprechung der Neuverfilmung der Kurzgeschichte folgt in einem gesonderten Text.)