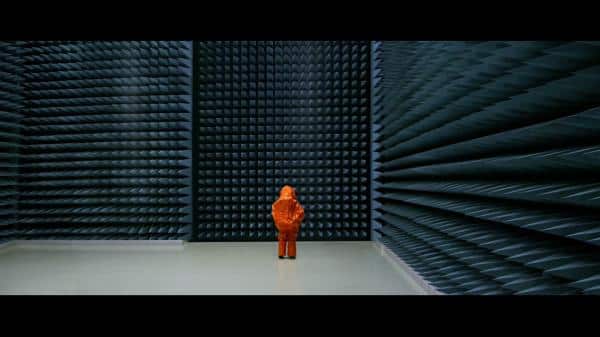So viel vorab: „The Mighty Quinn“ ist mitnichten ein schlechter Film. Dass er für mich trotzdem eine – wenn auch eher kleine – Enttäuschung darstellt, liegt einzig und alleine am Namen seines Regisseurs: Carl Schenkel. Die Begeisterung, die bei den drei anderen Filmen, die ich von ihm kenne, Besitz von mir ergriff, stellte sich hier dann doch nicht so recht ein.
Dabei sieht man dem Film durchaus an, dass sein Regisseur der begnadete Stilist ist, den man in Schenkel spätestens seit „Abwärts“ erkennen musste, der sich aber auch schon in den unendlich roughen, rohen Bildwelten von „Kalt wie Eis“ ankündigte. Die Einführung des Protagonisten ist eine Wucht: Die Kamera gleitet von seinen Füßen, überlebensgroß im Bild, an seiner verdammt schicken weißen Uniform empor und kommt schließlich auf dem Gesicht Denzel Washingtons zum Stehen, dessen Augenpartie von einer schwarzen Ray Ban-Sonnenbrille verdeckt wird. Wenig später wird von der Hochzeitsparty, auf der Quinn (Washington) sich zu Beginn befindet, und die das Geschehen des Films unschwer (und schon an den schönen Credits in Schwarz-Gelb-Grün) erkennbar in Jamaika verortet, auf den Leichenfund im Whirlpool einer Villa geschnitten. Aus dem Off erhallt dazu ein Frauenschrei, der sich nach einem weiteren Schnitt als Teil der Vocals des Vorspann-Songs entpuppt: „Guess who’s coming to dinner, Natty Dreadlocks“.
Die Figur Quinn, der aufrechte Polizist, der sich vor den Aufwartungen von Frauen verschiedener Hautfarbe kaum retten kann, der sozial tief in der Community, in der er lebt und arbeitet, verwurzelt ist (so verbindet ihn zu dem Kleinkriminellen Maubee (Robert Townsend), der bald unter Mordverdacht gerät, eine lebenslange Freundschaft) und dem bald klar wird, dass hinter dem Mordfall, in dem er ermittelt, mehr steckt als der erste Blick offenbart, es sich um ein großes (und internationales) Komplott handelt, hat ihre Wurzeln eher im in den Siebzigern florierenden Blaxploitation-Kino als in dessen weißen Vorbildern um James Bond und Co. Nur leider wird der Film dieser Referenz ans Genre-Kino der ja auch gerne mal etwas härteren Gangart kaum gerecht, bleiben Film und Figur hier relativ brav, was sich zum Beispiel schon in der strikten Monogamie Quinns offenbart. Der ist nämlich ein familiy man, der sich, auch wenn seine Ehe den ganzen Film über in einer ziemlichen Krise befindet (wie es Polizistenehen im Film nun einmal so an sich haben – immer aus den gleichen Gründen), den Verführungsversuchen verschiedener Frauen widersteht. Shaft wäre das nicht passiert.
Das Jamaika, in dem der Film spielt, bleibt eine überwiegend touristisch gefärbte Welt aus Reggae und Rum, Joints und Dreadlocks, Bounty-Stränden und farbenfroher Kleidung. Es ist nicht so, dass der Film sich dabei gänzlich unreflektiert geben würde. Die koloniale Vergangenheit wird nicht nur in einem Dialog zwischen Quinn und seinem Sohn explizit angesprochen, sie lebt auch in der Verteilung des Wohlstands zwischen Schwarzen und Weißen fort. Auch wird der Wert, den die Karibikinsel für die Tourismusbranche hat, in einem Dialog verhandelt, in dem ein Politiker von Quinn verlangt, die kriminellen Machenschaften möglichst schnell einzudämmen, damit die Touristen- und mit ihnen einhergehenden Geldströme nicht versiegen mögen. Dennoch ist das Problem von „The Mighty Quinn“ auch hier seine Geschmackssicherheit, dass er zwar, das belegt auch der deutsche Titel „Big Bad Man“, auf Exploitationvorbilder verweisen, aber mitnichten selbst Exploitation sein will. Ein Vergleich, der zeigen könnte, was das für ein Film sein könnte, wenn er denn wollte bzw. es seine Produktionsverhältnisse zulassen würden, ist der zu Ugo Liberatores leider vollkommen vergessenem „Bora Bora“ von 1968, der den Exotismus seiner Südsee-Postkarten-Panoramen in Cinemascope und Technicolor nicht nur gnadenlos ausstellt, sondern auch durch die Düsternis seines Plots konterkariert, durch den die kolonialistischen Neurosen und Phantasmen spuken, dass es nur so eine Art hat. „The Mighty Quinn“ bleibt dagegen einfach nur nett, was im Angesicht der Dringlichkeit, die Schenkels Vorgänger auszeichnete, eben etwas wenig ist.
Allerdings: Als kleine Utopie hat dieses Jamaika dann durchaus auch seinen Wert. Von der Tiefenentspannung, die diese Insel und ihre Bewohner hier auszeichnet, wird der ganze Film angesteckt, in dem es zwar etwas Action, Ehekrisen und böse weiße Ausbeuter gibt, der sich davon aber mitnichten aus der Ruhe bringen lässt, sondern lieber die Füße hochlegt, den tollen Reggae-Soundtrack aufdreht und einen Schluck aus der Rumflasche nimmt. Auf welcher Seite des Gesetzes man hier landet, ist auch ein bisschen eine Sache des Zufalls, was auch bedeutet, dass es einen nicht daran hindert, Freunde zu bleiben. So wie Quinn und Maubee. So wie der Gefangene in der Zelle des örtlichen Polizeipräsidiums, der mit den Beamten, die ihn bewachen, gemeinsam scherzt und auch mal ein Bier von ihnen abbekommt.