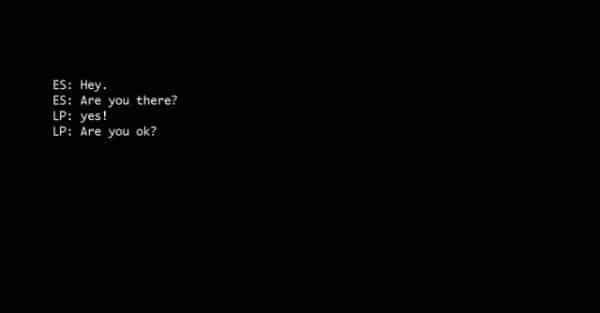Jaja, die Dardennes, man weiß nicht, wofür man sie mehr lieben soll, für ihre humanistische Einstellung oder für ihre Fähigkeit, gute Filme zu drehen. Manchmal trifft beides bei ihnen trefflich zusammen, und dann haben wir großes Kino: 'Rosetta', 'Das Versprechen', 'Der Junge mit dem Fahrrad'. Manchmal überwiegt das Sendungsbewusstsein, das Bedürfnis, eine Botschaft zu übermitteln: 'Lornas Schweigen' ist da ein Beispiel, bei dem mir zu penetrant unter die Nase gerieben wurde, wie verdammt wenig so ein Mensch im freien Spiel der ökonomischen Triebkräfte wert ist. Am besten hat sich ihr Kino immer dann bewährt, wenn das komplette kapitalistische Weltganze sich aus einer ganz kleinen und individuellen Problemgemengelage wie von selbst entwickelt und erklärt hat, wie es etwa bei 'Rosetta' musterhaft vorgeführt wurde.
'Rosetta' ist auch das Stichwort und der wichtigste Bezug zum neuen Film von den Brüdern Jean-Pierre und Luc Dardenne, denn 'Zwei Tage, eine Nacht' liegt die gleiche Ausgangssituation wie 1999 dem Film 'Rosetta' zu Grunde. Das Thema: der Kampf aller um zu wenige Arbeitsplätze für alle, also die künstliche Erzeugung von Konkurrenzverhalten, das Provozieren der egoistischen Kräfte, das gleichzeitige Aufspalten von Gemeinschaft zum Zweck der Dienstbarmachung, sprich: Ausbeutung der werktätigen Bevölkerung. Was für ein Spaß. Welche Filme ermöglichen heute noch ein dermaßen leichtgängiges Fluidieren ins marxistische Vokabular? Und wie wenige Filme nur sprechen heute noch von dem, was ja Grundlage und Spirit des kapitalistischen, also unseres alle und alles prägenden Wirtschaftssystems ist? So als wären das System und seine inhumanen Grundzüge und Auswirkungen allein schon dadurch human bzw. darüber nachzudenken dadurch tabu geworden, dass es kaum mehr ein nominelles, sprich ernstnehmbares, Gegenmodell, wie etwa einen Sozialis- oder Kommunismus dazu mehr gibt, denn wie auch immer -mus, Freunde: Diktatur ist Diktatur.
Umso schöner, wenn es noch Leute gibt, die trotzdem weiter über diesen anderen -mus nachdenken, der weiter (und hemmungsloser) existiert und weiter und mehr Probleme bereitet, und schön auch, dass dieses Nachdenken eben nicht ein dogmatisches Nachdenken ist, sondern eines, das deshalb Erkenntnis ermöglicht, weil es, günstigstenfalls, Argumente fallen lässt, die vielleicht rhetorisch passen würden, aber manchmal nur partiell einer Wirklichkeit entsprechen können. Das Nachdenken endet eben so nicht.
Womit wir zunächst wieder bei 'Rosetta' wären, der physischen Abbildung von Prekariat durch ein bis dato (1999) neues physisches Kino, Rosetta, eine in Armut lebende junge Frau, die um jeden Preis ihre Würde erhalten / erlangen möchte, in Form eines Arbeitsplatzes, die aber immer nur lernt, dass in unserer Art von Gemeinschaft niemandem irgend etwas zusteht, und dass sie mit allen Mitteln für ihr Ziel zu kämpfen hat, wenn es sein muss, auch gegen ihren besten Freund, wenn es sein muss, auch mit dem Mittel des Tötens.
'Rosetta', der Film, hatte schon damals spürbar klar gemacht, wie hart der Kampf ums Überleben geführt werden muss, wenn er den Gesetzen des Arbeitsmarktes entsprechen will, und diese These eindringlich bis zum Ersticken – oder bis zur Atemlosigkeit illustriert.
Man könnte sagen, mit der Heldin Sandra aus 'Zwei Tage, eine Nacht' lebt 'Rosetta' weiter, aber transformiert ins Ideelle, man könnte sagen, es geht nicht mehr um die Körper, die sich gegeneinander Geltung verschaffen, es geht um Ideen, die inkompatibel zu sein scheinen, und es geht um das Prinzip Hoffnung.
Sandra (die mit dunklen Augenringen versehene Marion Cotillard ('La vie en rose' [2007]), eine junge Mutter von zwei Kindern, war gerade länger in ihrer Probezeit krankgeschrieben, aber just im Moment, als sie von ihren Depressionen geheilt ist und anfangen will, wieder zu arbeiten, erklärt ihr Arbeitgeber (auch eine dieser, wie bei 'Rosetta' zu Beginn, virtuell erscheinenden Produktionsstätten, in denen die Arbeiter Schutzanzüge tragen, um ihre Produkte – in diesem Fall womöglich Solarzellen – nicht mit Menschenviren zu infizieren) ihre noch vorläufige Anstellung für entbehrlich, und er wälzt netterweise (und idealiter dardennesches Sozial-Exempel) die Entscheidung, ob sie gehen oder bleiben soll, auf Sandras 18 Kollegen ab: Im Falle, dass man ihren Arbeitsplatz einspare, ergebe sich eine einmalige Bonuszahlung von 1000 Euro pro verbleibendem/r Mitarbeiter/in. Und so sollen die Kollegen selbst entscheiden, was sie wollen, das Geld oder einer noch relativ unbekannten Kollegin ihren Arbeitsplatz erhalten.
Wie immer bei den Dardennes, setzt die Handlung ohne große Vorrede oder Einführung in dem Moment ein, als eine erste Abstimmung ohne ihr Wissen schon stattgefunden und sich gegen sie gewendet hat, und nur einer treuen Kollegin und der Unbeirrbarkeit ihre Mannes (gespielt vom auch in 'Rosetta' schutzengelgleichen Fabrizio Mongione) hat die fragile Sandra zu verdanken, dass sie erstens die moralische Unterstützung erfährt, die sie braucht, um zunächst einen Aufschub von einem Wochenende für eine zweite Abstimmung zu erwirken, und dann aber erst recht, um den Mut und die Kraft zu besitzen, jeden einzelnen dieser Kollegen persönlich mit der Tragweite ihrer Wahl zu konfrontieren, indem sie sie darum bittet, für sie, Sandra, also für die Erhaltung ihrer Lebensgrundlage und gegen die Lösung mancher eigener finanzieller Engpässe, zu stimmen.
Standen in 'Rosetta' die Unmenschlichkeit des Lebens ohne Arbeitsplatz und die Härte des freien Arbeitsmarktes im Mittelpunkt der Untersuchung, so setzt 'Zwei Tage, eine Nacht' diese Untersuchung eher als gegeben und als erfahren voraus und ergänzt sie nun, gewissermaßen als Fortsetzung der Phänomenologie einer allgemeinen Arbeitsethik, um die Frage nach einer möglichen Utopie. Der Film fragt konkret: Ist eine gerechtere und menschlichere Arbeitswelt heute oder überhaupt denkbar und möglich, und wenn ja, welche Voraussetzungen sind dafür bei jedem Einzelnen notwendig? Mit anderen Worten: Wie groß ist der Zusammenhalt zwischen den Kollegen / Menschen oder wie groß könnte er sein? Lässt sich eine andere, gerechtere Ökonomie überhaupt vorstellen ohne ein Opfer jedes einzelnen für den anderen?
Indem der Film der Frage nach diesem Opfer in exakt 18 Fällen nachgeht, spielt er sie so variantenreich durch, dass praktisch für jeden Zuschauer seine Option dabei sein müsste, wobei wir natürlich spätestens merken, dass Sandra nicht diese Kollegen, sondern die Dardennes unablässig uns fragen: Würdet ihr einen Menschen in die Arbeitslosigkeit gehen lassen, nur für diesen euren, vorübergehenden, persönlichen Vorteil? Natürlich würden wir nicht, gell?
Ein kleines Problem dabei ist, dass der Film anscheinend selbst der strategieimmanenten Konkurrenzideologie des Neoliberalismus ('Entweder der / die oder ich!') zum Teil folgt bzw. genauso auf sie hereinfällt, wie die, deren Entscheidungsprozess sie zugedacht ist, nämlich Sandras Kollegen (bzw. ein Großteil der freien Arbeitskräfte auf dem freien Arbeitsmarkt). Denn soziale Gerechtigkeit muss ja gar nicht zwangsläufig eine Frage des Opfers, des Verzichts oder gar der freiwilligen Armut der sich solidarisierenden Rest-Menschheit bedeuten, so wie es die Chefs von Sandras Firma suggerieren wollen, denn wenn man mal berücksichtigt, wie ungleich die Reichtümer heutzutage verteilt sind, ist sicherlich ganz schön viel für jeden (in der Welt) übrig.
Und so kommt es, dass bei der Frage des hier idealisierten freiwilligen Verzichts, des selbstlosen Opfers, unterschwellig eine christliche Kopfnote mitschwingt, die sich, man spürt es sukzessive und peu a peu, zu anderen gesellt, die der Film bereits vorher etabliert hatte: Sind nicht seine Grundfragen die nach den drei Theologischen Tugenden? Basiert nicht die Idee des Films auf der Idee des Glaubens (an das Gute im Menschen, das Göttliche)? Wird Sandra nicht durch die übermenschliche Liebe ihres Mannes durch die wohl schwierigsten Stunden ihres Lebens begleitet? Ist es nicht die Hoffnung allein, die ihr dazu verhilft, ihren Kampf darum, als Mensch wahrgenommen (angenommen) zu werden, nicht aufzugeben?
Hier tritt das oben bereits Angerissene ein: Die Entwicklung der Dardenne-Filme von einem (übrigens auch immer schon ethischen) Kino über existenziell und physisch determinierte Situationen des Menschseins hin zu einem Kino von Realität, konfrontiert und bewältigt (?) mit (christlichem) Ideal. Wenn es so sein sollte, dass die christliche Theologie die grundlegenden menschlichen Fragen treffend zu illustrieren im Stande sei, und sie nicht, umgekehrt, eher an den grundlegenden menschlichen Fragen zu Gunsten ihrer Ideologie geschraubt habe, dann ruhe mein Segen auf den neueren Dardenne-Tendenzen.
Aber muss es sein, dass mir die Auflösung eines weitgehend spannenden und wieder mal wahrlich engagierten Dardenne-Films das Gefühl gibt, ich müsse von ihm zusätzlich ob seiner inhärenten Moral belehrt werden? Ich weiß nicht und gebe 7 bis 8 Punkte, was sich in unseren filmgazetten-Standardbewertungen nicht widerspiegelt.