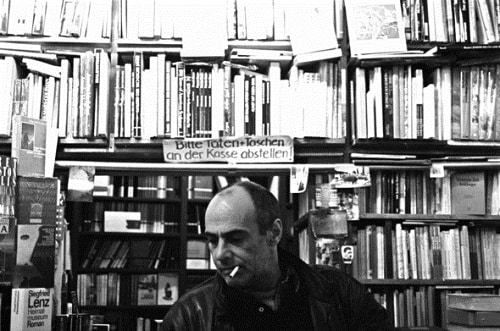Regisseur Nicolas Roeg und Drehbuchautor Dennis Potter führen in ihrem neuesten Film, der Mitte Januar in der Bundesrepublik startet, Hör- und Sehgewohnheiten vor, dass einem Hören und Sehen vergeht
Ein Film, den man hemmungslos empfehlen kann. Einsteigen in den Chattanooga Choo Choo. Abfahrt bekanntlich Gleis 29. 'Pardon me, boy, is this the Chattanooga Choo Choo? Yes, yes! Track 29! All aboard!' Musik (Harry Warren) und Text (Mack Gordon) dieser Nummer aus dem Jahr 1941. Auch die anderen Hits sind aus der Zeit von Urahne, Großmutter, Mutter und Kind: 'M.O.T.H.E.R.' (Theodore Morse und Fiske O.Hara, 1915), 'When The Red Red Robin Comes Bob Bob Bobbin‘ Along' (Harry Woods, 1926), 'Young At Heart' (John Richards und Carolyn Leigh, 1954), 'Mother' (John Lennon, 1971). Die Songs, voll gepackt mit Emotionen und Lebensweisheiten, Anklagen und Ermutigungen, appellieren ans Gemüt dieser amerikanischen Normalstbürger, die in mehr oder minder dumpfer Stube versammelt sind. Ein traumatisches Emotionaldefizit: 'Mother, you had me, but I never had you, I wanted you, but you did’nt want me' (John Lennon). Empfehlung: 'Engstirnigkeit vermeiden, über Alpträume lachen. Das Unmögliche wa`gen, zum Äußersten gehen – to be young and high' (Carolyn Leigh).
Der Alltag im kleinstädtischen North Carolina – gedreht ist der Film in Wilmington und Wrigthsville Beach – ist normal, typisch amerikanisch, eben Horror, Alptraum, Engstirnigkeit. Wieder wird Linda (Theresa Russell) von ihrem Gatten abgefertigt, wenn sie den Wunsch, begattet zu werden, signalisiert: 'Das ist nicht möglich, Linda', sagt Dr. Henry Henry (Christopher Lloyd), Oberarzt der gerontologischen Abteilung im städtischen Krankenhaus. Dann setzt er zur Attacke gegen die unmöglichen Frauenwünsche an, nämlich seine Modelleisenbahnanlage in Betrieb, er schiebt eine Diskette ein: 'All aboard', und dann jagt der häusliche Chattanooga Choo Choo durch die Zimmer, dass es der armen Linda ein Alptraum ist. Empfehlenswert ist in dieser Situation ein großer terroristischer Anschlag.
Kaum gedacht, schon gezeigt. Der Film verhilft ihm zu blutiger Realität, genauer gesagt: der junge Martin (Gary Oldman) tritt in Aktion, ein Zugereister aus dem fernen Engelland, eine unmögliche Kombination von Sohn, Liebhaber und Rächer. Wenn er mit seinen starken Fäusten die Modellwagons zerquetscht, teure Sammlerstücke, fließt rotes Blut heraus. Aber möglicherweise ist der starke Mann nur eine neue, bisher unterdrückte Seite von Linda, denn als sie das Äußerste wagt und mit dem langen Küchenmesser nach oben geht, wo Gatte Dr. Henry am zentralen Eisenbahnschaltpult Regie führt, sieht man den jungen Martin eben dieses Messer schwingen. Splitternackt springt er bzw. sie dem Doktor an die Brust und stößt die Klinge tief in den Rücken, dass das Blut durch die Decke tropft. Lachend, young and high setzt sich Mutter Linda keck einen unmöglichen Hut auf, weiß mit großen schwarzen Punkten, startet ihr Kabriolet und bloß weg aus Wilmington.
Ich könnte schwören, daß ich diese Szene schon in einem Film gesehen habe. Aber in welchem? Keine große Schwierigkeit war es, Martins Mutter, 'a cleaning woman', im Kultfilm 'Tote tragen keine Karos' zu finden. Und wenn Martin mit seinen groben Affenhänden nach den Choo-Choo-Zügen greift, wie sie grade über die Hängebrücke fahren, dann ist das King Kongs schiere Kinowirklichkeit. Martin, der Retter, scheint jedoch auch aus den unendlichen Mysterien des Kosmos zu kommen, einer TV-Serie aus dem ewig laufenden Fernseher entsprungen. Einen SF-Helden menacing reality kündigt eine off-Stimme im TV-Gerät an. Linda hört mit einem Ohr hin; die Realität, in der sie lebt, kann gar nicht genug bedroht werden. Und schon ruft es grausig und hilfeflehend im Weltenraum: 'Mami, Mami', und ein Kind sucht seine Mutter. Später sind es Filmsequenzen auf dem Monitor, deren Handlung Linda aufgreift und weiterführt, wie zufällig. TV-Comic-Strips erlauben Bildverkürzungen und sprechende Nahaufnahmen. Linda sieht sich als Fünfzehnjährige wieder auf dem Jahrmarkt im Elektroscooter. Hinter ihr steht einer im Wagen. 'Blitzelblitzel' macht der Kontaktschleifer an der Decke. Die Großaufnahme erzählt die erste – böse – Liebesgeschichte. Für die, die Comics gelesen haben, also für alle.
Kurzum, 'Track 29' ist eine schrille Horrorkomödie. Und eine satte antiamerikanische Satire. Und ein mediales Kunstwerk ohnegleichen. Weil zum erstenmal konsequent und intelligent und souverän mit den Hör- und Sehgewohnheiten derjenigen operiert wird, die den Film hören und sehen – , so wenig konsequent und intelligent und souverän diese Rezeptionsformen sein mögen. Aber sie sind inzwischen selbst Realität geworden, haben sich an die Stelle dessen gesetzt, was wir äußere Wirklichkeit nennen. Regisseur Nicolas Roeg ('Wenn die Gondeln Trauer tragen', 'Castaway') ist es mit Hilfe eines überaus erfindungsreichen Drehbuchs (Dennis Potter) gelungen, die neue (mediale) Wirklichkeit operabel, für den einzelnen handhabbar zu machen und durch eine subversive Ästhetik die konservativen Lebensformen zumindest in North Carolinas Kleinstädten grinsend-grimmig zu attackieren. Wer den ganzen Tag den TV laufen lässt und eine Musi-Kassette nach der anderen einwirft, dem kann man nicht mit schlauen Diskursen kommen und mit sauberer Argumentation. Roeg und Potter haben stattdessen in 'Track 29' Hör- und Sehgewohnheiten vorgeführt, hör zu, sieh zu, die Dekoration, die Schauspieler, die Montage und Collage sind wichtiger als die Literatur und der explizierende Dialog. Verbal wird uns in diesem Film am wenigstens erzählt, und das unterscheidet ihn auf das Angenehmste von all diesen amerikanischen Filmen, in denen uns erklärt wird, was wir nicht gesehen und gehört haben und was wir infolgedessen nicht glauben können.
'Track 29' ist ein in US-Amerika produzierter Film, aber eine ziemlich Un-American activity. Ich würde sagen: very British. Erstens wegen Martin. Im Hämburger Place stellt er sich vor: 'My name is Martin. I’m from England', um festzustellen, dass er sich an diesem Ort nicht verständigen kann, jedenfalls nicht verbal über die Frage, wie er die Spiegeleier haben will. Autor Potter ist Brite, und er hat eingestandenermaßen in 'Track 29' den Kulturschock verarbeitet, den ihm Anfang des Jahrzehnts Los Angeles bereitet hatte: 'Das ist eine Stadt, die nicht nur physische Hässlichkeit kennzeichnet, sondern auch ein akuter geistiger Terror. ‚Track 29‘ spielt in einer Kultur, die die Menschen nur allzu leicht ihrer Identität beraubt'. Nicolas Roeg und Hauptdarstellerin Theresa Russell ('Die schwarze Witwe'), verheiratet, leben in London. Von hier aus verkündet Roeg sein Credo, dass 'Kino die Kunstform unserer Zeit ist' und dass er mit diesem Mittel 'Barrieren durchbrechen will'. Ehefrau Theresa Russell hatte sich bereits 1979 bei der Aufdeckung des Watergate-Skandals engagiert. In 'Blind Ambition', einem Film der auf John Deans Enthüllungen basierte, spielte sie die weibliche Hauptrolle.
Die britische Antwort auf den American Way of Life liefert am anschaulichsten und eindrücklichsten der Martin-Darsteller Gary Oldman, der zuletzt in 'Prick Up Your Ears' von Stephen Frears zu sehen gewesen ist. Ein hochtalentierter Schauspieler, der in 'Track 29' gefordert war – in einer Rollen- und Identitätenvielfalt, nämlich in immer neuen Ausgeburten von Lindas deformierter Phantasie. Eine glänzende schauspielerische Performance. Ein sechsjähriger, ungezogener, weinerlicher, trotziger Junge. Ein romantischer Liebhaber. Ein Engländer from Outer Space. Und gleichzeitig immer wieder Linda selbst: die defizitäre Frauenidentität. Rollenwechsel, Rollenspiel und Identitätserprobungen sind die britische Antwort auf Frust, Verkrustung und Stuss des American Way. 'Do you like games, Mami', fragt der junge Mann mit der Stimme des Sechsjährigen und fasst der schönen Linda unziemlich an die Brust. Schau-Spiele. Dann sagt er zu ihr: 'You can kiss me if you want'; aber das ist nicht seine, sondern Lindas Identität, die sich ins Spiel bringt.
'Track 29' ist ein Film des Schauspiels, der Akteure. Sie sind so gut und ungewöhnlich, wie man es sich aus therapeutischen und britischen Gründen nur wünschen kann. Listiger- und tückischerweise ist der Film so angelegt, dass die Schauspieler, sofern sie nicht britisch sind, aus der Rolle des typischen Amerikaners nicht herauskönnen. Zum Beispiel ist dem Dr. Henry Henry der 'Chattanooga Choo Choo'-Song zu weiter nichts als einem perversen Spielchen nütze, nämlich immer demselben. Christopher Lloyd spielt die lustige Masoszene mit derselben Mimik, wie er sie als Sado-Nazirichter im 'Falschen Spiel mit Roger Rabbit' zur Schau stellte. In 'Track 29' wird uns der Hit von 1941 wieder abgewöhnt, wenn Schwester Stein (Sandra Bernhard, mein Gott: seht Euch dieses Antlitz an!) die sterilen, aber roten Handschuhe überstreift und mit Inbrunst sowie im Takt auf den bloßen Oberarzthintern schlägt, dass die Lustschreie gellen und die Patienten auf ihren Rollstühlen aus der Fahrbahn geraten, draußen im Gang.
Christopher Lloyds Mimik ändert sich auch nicht, wenn er in einer großen Szene zum Präsidenten der Modelleisenbahnergesellschaft gewählt wird. Der Trainorama-Auftritt ist öffentlich und die Quintessenz aller TV-Aufnahmen, die wir vom amerikanischen Wahlkampf gesehen haben. Unter dem Union Jack fordert er geistige Disziplin und militärische Zucht. Was hat unsere große Nation zusammengeführt? Die Gleise waren es! (Zurufe, Zuschauer erheben sich von den Plätzen, Frauen heulen vor Rührung) Ich sage, was ich fühle. Wollt Ihr es wissen? (Ja! !) Ich schließe meine Augen. Ein Bild aus alten Zeiten. Wo wir wussten, wer wir waren, wo wir waren und wohin wir gingen. (Euphorische Schreie, orgiastischer Applaus, Luftballons steigen, der Chattanooga Choo Choo fährt ein, besetzt mit Girls, die rhythmisch mit ihren Tambourstäbchen schlagen, und unser Dr. Henry Henry-Darsteller stößt wieder seine Lustschreie aus, es sind die gleichen wie auf dem perversen Operationstisch im Stationstrakt, und es ist auch die gleiche musikalische Nummer. Womit Lloyds Spiel mimisch, aber leicht einsehbar bewiesen hat, dass zwischen privater und öffentlicher Perversität keinerlei Unterschied besteht und der schöne Chattanooga Choo Choo nebst reichster Hör- und Seherfahrung nichts nützt, wenn er lediglich als Reizauslöser für zwanghafte Wiederholungen benutzt wird, eben für den American Way of Life mindestens in diesem North Carolina).
Drehbuchautor Potter, Sohn eines Grubenarbeiters und Labour-Parlamentskandidat in den sechziger Jahren, hat die Konservativismus- und Nationalismusorgie dieses Wahlkampfs kenntnisreich nachempfunden und auf den Höhepunkt getrieben, und Regisseur Roeg hat in den Schauspielerorgasmus Szenen der Zerstörung, der Anarchie und des Umsturzes hineingeschnitten: eine manische, aber verdiente Antwort. Gott sei Dank gibt es King Kong, der Dr. Henry Henrys Lebenswerk plattmacht und seine Lustschreie abwürgt. Jeder, der Kinoerfahrung hat, weiß, wie das geht.
Zum Schluss des Horrortages ruft Linda die Freundin Arlanda (Colleen Camp) zu Hilfe. Arlanda ist unvergesslich, wie sie sich mit dem Papiertaschentuch die feuchten Achseln trocken reibt und im allerneusten Fitnessdress die Hanteln stemmt. Sie hat als typische Amerikanerin nichts gesehen und nichts gehört. Nicht mal den naughty boy Martin kriegt sie mit, selbst wenn sie danebensteht und er mit ihr spricht. Aber nun muss sie wählen. Zwischen der offenbar schwer psychotischen Linda und dem nicht minder geschädigten Gatten. Dr. Henry Henry lässt den Macho raushängen: 'Ich bin ein Doktor! Ich weiß, was ich tue', brüllt er und ohrfeigt seine Frau im Takt der roten Handschuhe, denn 'women and trains don’t mix'. (Ich nehme an, im Kino wird dies eine deutsche Synchronstimme sagen). Arlanda übt daraufhin Frauensolidarität und entscheidet: 'Herr Dr. Henry, Sie sind es, der verrückt ist', womit das amerikanische Upperclassdrama auch als das Drama einer Geschlechterunterdrückung definiert wird. Die Frau, daheim in der perfekten Zivilisation zwischen Massagestab und Swimmingpool, allein und einsam, sie registriert zuerst, dass 'das Leben leer, sinnentleert und zwecklos ist' (Linda). So dass der Aufbruch auf Gleis 29 mit Musik und allerlei Rollenspiel am besten von Frauen betrieben wird, die sich unartige aber liebe Jungs dazuholen, welche andererseits nichts anderes als manifeste feminine Hirngespinste zu sein brauchen. – Stimmt das Fazit? Egal. Einsteigen und abfahren ist immer noch besser als dableiben. In Wilmington.
Dieser Text ist zuerst erschienen in: Konkret 01/1989