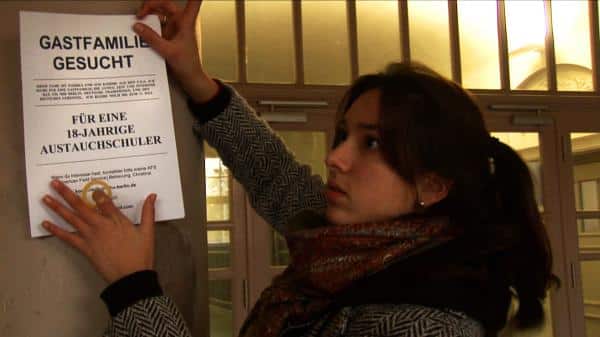Henrys Frau hat schlechte Eigenschaften. Sie hat Tics, belegt zwei Drittel des schmalen Bettes und das Schlimmste: Sie hat mit Henry ein Baby. David Lynchs Erstling ist bald ein Vierteljahrhundert alt, aber bis heute lässt allein das Wort „Eraserhead' das Herz des wahren Cineasten höher schlagen.„Eraserhead' war 1977 noch kenntnisreiche Neugestaltung (z.B. surrealistischer) filmischer Vorgaben und schon die Zukunft künstlerischen Kinos, aber es ist doch erstaunlich, wie einzigartig der Film immer noch geblieben ist. Falls Atmosphäre zu schaffen eine der höchsten Künste des Kinos ist, dann ist „Eraserhead' eines der größten filmischen Kunstwerke. Lynch, der Beschwörer des Unbewussten, hat mit nur 20 000 Dollar eine wirklich ganz eigene Welt kreiert und 'nur' fünf Jahre dafür gebraucht.
Henry Spencer, ein Drucker mit Dauerurlaub, wohnt in einem abbruchreifen, dunklen Arbeiterwohnsilo, in einer permanenten Nacht und in einer Gegend, in der Maschinengrollen und Dauerunwetter Anheimelnderes, wie etwa Vogelgezwitscher oder selbst Autolärm ersetzt haben. Vielleicht könnte er gleichmütig weiterleben in seinem Zimmer mit Sicht auf eine Backsteinmauer, würde nicht das Schicksal in Form einer Einladung zu Mary und ihren Eltern anklopfen. Henry hat ihr Foto noch, aber er hat es zerrissen, weil sie ihn verließ. Was er erfahren wird? Er weiß es eigentlich schon, denn Henry hat Zugang zu einer Hyperrealität. Wir waren gleich zu Beginn Zeugen seines Traums von einer überdimensionalen Spermatozoe, die Henrys geöffnetem Mund entspringt, ihren Auftrag erfüllt und in die Eizelle fällt, wie in einen Brunnen. Wir konnten verfolgen, wie im Inneren eines kahlen, mit Kratern bedeckten Himmelskörpers ein aussätziger, degenerierter Gott den Hebel kippt und sein unabänderliches Gesetz vollzieht: Die Initiierung des ewig wiederkehrenden Wunders neuen Lebens. Wir waren Zeugen einer Zeugung.
Bei Marys Eltern verrät auch gleich eine Hundemutter mit schmatzend saugenden Welpen, worauf die Veranstaltung hinaus läuft. Nach einem makabren Abendessen mit (laut Marys Vater) 'synthetischen Hühnchen', die, als Henry sie tranchiert, beginnen mit den Schenkeln zu wackeln und aus ihrer Mitte stark zu bluten (die Assoziation zu Monatsblutungen ist unvermeidlich), bekommt die Mutter einen hysterischen Anfall und entfernt sich, während das Gesicht des Vaters zu einem Dauergrinsen erstarrrt ist. Als die Mutter halbwegs gefasst wiederkehrt (und kurz nachdem sie sich Henry sexuell genähert hat), wird Henry aufgeklärt: Mary hat ein Baby bekommen – nur weiß man noch nicht genau, ob es wirklich ein Baby ist … Da auf jeden Fall Handlungsbedarf besteht, muss Henry Mary ehelichen (die Hochzeit wird nicht gezeigt) und Mutter und 'Kind' ziehen bei ihm ein.
Very Special Effects
Ein bis heute gut behütetes Geheimnis ist, was für die Verkörperung des unheimlichen kleinen Geschöpfs benutzt wurde. Es sieht sehr nach einem tierischen Fötuskopf aus, dessen dürrer Hals aus einer Art Dauerwindel, einem in Mullbinden gewickelten arm- und beinlosen Leib ragt. Mit seiner glitschigen Haut, den rollenden Augen, und dem schmatzendem, spuckendem Maul (incl. Zunge) wirkt es so überzeugend lebendig und organisch, dass etwa Spielbergs wesentlich kostspieligere „E.T.'-Kreatur (1982) sich dagegen harmlos und als nur 'gut gemacht' ausnimmt.
Zunächst versucht Henry die Vaterrolle zu akzeptieren. Er kümmert sich um seine Post (einen merkwürdigen kleinen Wurm, den er, vor Mary versteckt, in einer Art heiligem Schrein aufbewahrt), und beobachtet Mary gerührt, während sie das Baby füttert. Es wird (wie während des ganzen Films) kaum gesprochen. Neben ihm im Bett liegend, weist Mary einen (einzigen) Annäherungsversuch Henrys zurück. Als schließlich das Baby beginnt, immer ausdauernder zu weinen, flieht sie zu ihren Eltern und lässt Henry mit dem Kind allein.
Das Kind bekommt Fieber und Ausschlag; Henry stellt einen Luftbefeuchter auf die Kommode, wo es auf einem Kissen liegt und röchelt. Immer wenn Henry versucht, den Raum zu verlassen (um nach Post zu sehen – anscheinend haben jene postalischen Würmer für ihn zentrale Bedeutung), beginnt das Baby zu schreien, so dass er sich stattdessen resigniert aufs Bett legt.
Zwischen drei Frauen
Da entdeckt er die 'Frau hinter der Heizung'. Henry sieht, wenn er lange hinter den Heizkörper schaut, eine kleine Bühne, auf der jetzt eine gleichzeitig naiv und starr lächelnde blonde Tänzerin in weißem Kleid mit erkennbar aus Knetmasse modellierten Halbkugelwangen staksig mit kleinen Tanzschritten umherspaziert. Neben ihr auf den Boden fallen mehrere (Henry und uns vom Anfang her bekannte) aalgrosse Spermien, deren dabei spritzend berstende Köpfe sie lustvoll zertritt. Als Henry wieder erwacht, ist Mary zurückgekehrt. Sie liegt zähneknirschend in unruhigem Schlaf neben ihm. Zu seinem Entsetzen findet er unter ihrer Decke wiederum Spermatozoen. Panisch zerrt er sie wie leblose Schlangen offenbar direkt aus ihrer Vagina und wirft sie gegen die Wand, an der sie zerplatzen. In diesem Moment erwacht der kleine Wurm im sich von selber öffnenden Schrein zum Leben. Er ringelt sich, tänzelt und pfeift dabei eigentümlich. Im Dunkel seines aufgerissenen Mauls sehen wir wieder Henry in seinem Raum sitzen; Mary ist verschwunden.
Es klopft, Henry öffnet und aus dem Dunkel tritt seine laszive Nachbarin, deren begehrliche Blicke ihn schon vorher irritiert haben. Unter dem Vorwand sich ausgesperrt zu haben, verführt sie den ängstlichen, aber willigen Henry, der dem Baby den Mund zuhält, um sie nicht abzuschrecken. Das Bett wird buchstäblich zu einem Sündenpfuhl, in dem beide versinken. Der Akt führt zu einer Auflösung, die Auflösung zu einem schwarzen 'Nichts', in dem die Nachbarin allein bleibt und sie statt Henry nur noch seinen 'Kraterplaneten' taumeln sieht.
Manufaktur der Amnesie
Henry ist zur gleichen Zeit dem Ziel seiner Träume nahe gerückt. In Großaufnahme sehen wir jetzt die 'Heizungsfrau' ein Lied vom Himmel singen: 'In heaven everything is fine – you‘ve got your good things and I‘ve got mine.' Auf einmal ist Henry bei ihr, steigt zu ihr auf die Bühne, sie erwartet ihn, aber gerade als er sie berühren will, verschwindet sie und der pockennarbige Gott erscheint kurz an ihrer Stelle. Als auch er nicht mehr da ist, kommt eine Art Erdklumpen mit einem dürren blattlosen Strauch auf Rädern auf die Bühne gerollt, Henry ist sichtlich beängstigt, sein Kopf wird von einem phallischen Etwas aus seinem Inneren vom Rumpf gestossen und auf den Boden der Bühne geschleudert, der Erdklumpen beginnt zu bluten, aus Henrys Hemdkragen lugt nun der Kopf des Monsterbabys, das zu schreien beginnt. Henrys Kopf wird plötzlich von der Blutlache verschluckt, knallt auf eine Strasse, wo er von einem Jungen gefunden wird. Der Junge trägt ihn in eine dubiose Werkstatt, in der 'eraserheads', also Radiergummiköpfe für Beistifte hergestellt werden. Mit einem Hohlbohrer wird Henrys Gehirn stabförmig ausgebohrt, der Stab wird mit einer Maschine zerteilt und auf Bleistifte gepflanzt. Nach einem Radiertest wird der Junge bezahlt. Die Radierspäne fliegen, und – Henry erwacht in seinem Bett.
Das Baby ist immer noch auf der Kommode und lacht schadenfroh. Als Henry ein Geräusch auf dem Flur hört, sieht er nach und sieht die Nachbarin mit einem schmierig grinsenden Mann nachhause kommen, ihr selbst wiederum erscheint anstelle von Henrys Kopf der Kopf des Babys. Wieder allein in seinem Appartement nimmt Henry eine Schere und beginnt die Binde um den Babykörper aufzuschneiden. Das Baby windet sich. Aus dem aufgeschnittenen Verband dringen Innereien und Henry sticht ins Herz. Das Baby spuckt Blut, verendet, aus seinem Inneren quillt eine schaumige Masse, die Steckdose sprüht Funken, die Lampe brummt, flackert und erlischt. Das Monster ist tot. Der Planet erscheint wieder und die Kruste bricht auf, er ist innen hohl. Hinter Henrys Kopf wirbeln Radierspäne. Im Inneren des Planeten: Der Mann im Planeten (Gott), der vergeblich versucht den Hebel umzulegen. Der Hebel klemmt und wieder sprühen Funken. Alles wird hell, und Henry ist bei der Frau hinter der Heizung, sie umarmen sich, und der Film ist zu Ende.
Eine Bewusstseinsgeschichte?
„Eraserhead' ist ein Mosaik, das ohne die Intuition des Zuschauers nicht zusammengesetzt werden kann, und die Vielfalt der dabei individuell entstehenden Gesamtbilder ist bei „Eraserhead' wahrscheinlich größer als bei den meisten späteren Lynch-Filmen. „Eraserhead' ist auch in seinen 'normalsten' Szenen immer schon ein reines Traumszenario. Und es gibt mindestens noch drei Parallelrealitäten, die sich auf die 'normale' Ebene beziehen. Alles zusammen lässt sich wie verschiedene Bewusstseinsebenen eines Menschen zu einer komplexen 'Bewusstseins-Geschichte' desselben zusammenfügen. Aber zu welcher?
Der, was die Inhalte seiner Filme betrifft, verschwiegene Lynch ('Ich liebe die Vorstellung, dass etwas für unterschiedliche Leute unterschiedliche Bedeutung haben kann.') hat selbst folgenden Hinweis gegeben (und damit angedeutet, dass die Geschichte für ihn gleichwohl ein Rätsel mit einer bestimmten Lösung ist): 'Es passieren gewisse Dinge in der (Prolog-) Sequenz, die der Schlüssel zum Rest sind.'
Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass obige Deutung der Anfangssequenz mehr oder weniger zutrifft, handelt es sich dabei also um einen Zeugungsvorgang, erschließt sich Stück für Stück folgende (vorsichtige) Lesart:
Henrys Leben befindet sich zwischen zwei Polen: Dem, was er sich erhofft, und dem, was er als Welt vorfindet. Sein Hauptproblem ist sein eigenes Kind, weil es ihn in jeder Hinsicht einschränkt und weil es mönströs und zumindest befremdlich für ihn ist. Das Kind steht auch für die Verbindung zu Mary, die (ohne Liebe von ihrer Seite) eine Zwangsehe ist, ein Sicheinrichtenmüssen in einer freudlosen Welt. Die freudlose Welt findet sich generell als düstere Außen-und Innenkulisse wieder. Und die Ehe und Familie, als Institutionen freudloser Zweckmäßigkeit, werden in den absurden Typisierungen von Marys Eltern (und der Großmutter, die reglos auf einem Stuhl sitzt) gespiegelt: Hier hat schon bis zur neurotisch verzerrten Erstarrung seine Rolle gespielt, und Henry ahnt, dass ihm das Gleiche bevorsteht.
Die 'Pille' und 'Eraserhead'
Henrys Wunschtraum (ein geheimnisvolles Hilfsmittel zu dessen Verwirklichung ist der Wurm) ist die Vereinigung mit der Traumfrau hinter der Heizung. Sie verheißt ihm eine freie Welt, in der alles schön ist,- und in der es keine Befruchtungen (also weder bedrohliche (Miss-)Geburten noch deren bedrohliche Schwester: die Zwangsehe) mehr gibt, denn sie weiß, wie sie gezielt Spermien töten kann (Wenige Jahre nach Einführung der Antibabypille ist diese erste relativ zuverlässige Verhütungsmethode für Lynchs Film vielleicht von nicht geringer Bedeutung gewesen). Im Gegensatz zur frustrierten, spröden und hausbackenen Mary lächelt sie freundlich – und gleichwohl hausbacken. Henry muss jedoch, bevor er sie gewinnen kann, Prüfungen bestehen, die ihm eher zustoßen, als dass er sie aktiv meistert, bis auf die letzte, wichtigste. Henry ist eher ein Abenteurer des Unbewussten, sein Abenteuer ist sein Träumen.
Henrys anderer, verdrängter und feuchter Wunschtraum ist die Verführung durch die Nachbarin, aber sie hat mit Mary gemeinsam, dass sie ihn nicht liebt. Nach dem Geschlechtsakt mit ihr versucht er zur Heizungsfrau zu gelangen. Doch nun stellt sich sein Hauptgegner, sein privater Dämon, der Schöpfer seiner widrigen Umstände, der 'Mann vom Planeten' in den Weg und entweder ist er es, der Henry köpft, oder das Baby. Das Baby ist jedenfalls nun das, was für ihn denkt und aus seinem Anzug guckt, während seine eigene Gehirnmasse nur noch der Auslöschung dient. Das Gehirn als Instrument zum Ausradieren des Wortes und der Erinnerung – eine exakte Umkehrung seiner herkömmlichen Funktion. Das Radieren einerseits als Tod und Verlöschen der Identität, andererseits als Befreiung von einer Identität, die Henry in Ketten gehalten hat.
Erst nach diesem Traum (und nach Henrys Enttäuschung, die Nachbarin mit einem anderen zu finden) ist es ihm möglich, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Er zerschneidet die Windeln und entdeckt die endgültige Monstrosität des Babys, und nachdem er es als Lüge entlarvt hat -es ist ja nun wirklich alles andere als ein menschliches Wesen-, kann er sich von ihm befreien, indem er es tötet. Aber mit diesem Schritt entlarvt er auch den Hebelsteller, den Gott, der im Planeten sitzt, dessen Weltenplan der obszönen Sinnlosigkeit überführt ist. Durch den Kindsmord hat Henry gleichzeitig die Schöpfungsmaschinerie zerstört. Gottes Gesetze, seine Hebel, funktionieren nicht mehr, und Henry ist frei. Der Vereinigung mit der geliebten Heizungsfrau steht nichts mehr im Wege.
Das Unbewusste als Filmplot
„Eraserhead' ist ein Film über eine Emanzipation und ich glaube, er ist einer der persönlichsten Filme Lynchs. Lynch selbst hat zugegeben, dass er vieles mit Henry gemeinsam hat, und wenn wir Henry bei seinem Tagtraum beobachten, in dem ihm die Heizungsfrau erscheint, vollziehen wir genau das nach, was Lynch selber (der während der langen Dreharbeiten wegen Geldmangels selbst in Henrys Filmzimmer gewohnt hatte) angesichts der Heizung phantasierte. An diesem Beispiel können wir uns ein Bild darüber machen, wie Lynch seine phantastischen und absurden Filmideen zu gewinnen pflegt. Er bezieht seine (filmischen) Ideen und Vorstellungen aus Tagträumereien, aus freiem Assoziiieren, und Henrys Vorgehensweise ist exakt dieselbe. Um sein Problem zu lösen braucht Henry jene parallelen Bilder und Symbole, ohne sie würde er in seiner grauen, bedrohlichen und frustrierenden Realität gefangen bleiben. Er schafft Beziehungen zwischen den Ereignissen und seiner Imagination, und allein mit ihrer Hilfe kann er die Dinge in ihrer für ihn wirklichen und gänzlichen Bedeutung erkennen, und verändern, bzw. sich von ihnen befreien.
Die Umstände, dass der junge Lynch zur Entstehungszeit von „Eraserhead' gerade geheiratet hatte, Vater eines gehandicapten Kindes geworden war und sich während der Dreharbeiten von seiner Frau getrennt hatte, waren für die Entstehung des Films sicher nicht ohne Einfluss. Das Schöne an „Eraserhead' ist aber, dass dieser Film nicht nur eine persönliche, private Problematik abdeckt, sondern dass er quasi unbegrenzt und universell einsetzbar ist. „Eraserhead' skizziert, in einer erweiterten Perspektive, z.B. auch generell den Konflikt eines kreativen Menschen, der die für seine Kreativität notwendige Unabhängigkeit durch Ehe und Familie bedroht sieht und er malt ein düsteres Bild von den (subjektiven) Schrecknissen einer zu frühen Vater- oder Mutterschaft (Statt des eigenen Kopfes regiert das Baby über einen).
Maschine, Atom und Mutation
Aber wenn wir es ganz groß haben wollen, dann ist „Eraserhead' auch ein (von Frederick Elmes in magischem Schwarzweiß gedrehter) Film über eine unheimliche und menschenfeindliche Welt, deren Ästhetik sich aus der Epoche bedient, welche unseren Planeten während der letzten zwei Jahrhunderte am nachhaltigsten geprägt hat, der Industrialisierung. 'Eraserhead' wirkt, als wäre seine Zeit im düster-kapitalistischen England des 19. Jahrhunderts steckengeblieben (der Mensch wird restlos ausgebeutet, selbst Henrys Gehirn wird maschinell zu einem materiellen (!) Produkt verarbeitet), aber die Stürme und Unwetter (die nur akustisch wahrnehmbar sind und dennoch den Film dominieren) und die ewige Nacht erwecken den Eindruck einer vorher gegangenen atomaren Katastrophe (an Henrys Wand hängt ein Foto von einem Atompilz). Henry lebt offenbar in einer Postapokalypse, die selbst den zum Maschinisten degradierten Gott einer mechanistisch-industriellen Welt nicht verschont hat: Armselig und strahlenverseucht hockt er in einer Fabrikruine und herrscht über einen kahlen, toten Planeten. (Im ganzen Film übrigens gibt es kein Blatt und die Hähnchen sind synthetisch.) Natürlich ist Henrys Baby eine radioaktive Mutation. Das 'Baby' ist das End(zeit)produkt einer langen Kette der Technologisierung (wenn man es weiterspinnen will, bis zur Gentechnologisierung), und „Eraserhead' ist nicht weniger als eine kurze, präzise komprimierte Geschichte der monströsen Moderne,- unter anderem …
„Eraserhead' ist komisch, tragisch, kulturkritisch, surrealistisch, ein Stummfilm mit Ton, und/oder ein Horrorfilm. Es hängt vom Betrachter und seiner Tagesform ab. Interpretieren Sie mit, und bitte FÜHLEN Sie diesen Film! Schon lange ist „Eraserhead' Kult, aber vor allem ist „Eraserhead' ein Meisterwerk,- ganz egal, was ich Ihnen einreden will …