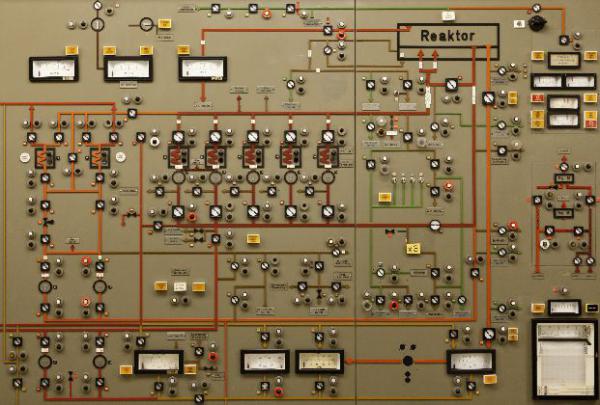Gottseidank sind die Zeiten vorbei, in denen der Gebrauch eines Wortes wie „Faszinosum“ im Zusammenhang mit Hitler hierzulande für Irritationen sorgen und Karrieren zu einem jähen Ende verhelfen konnte. Dass deutsche Vergangenheitsbewältigung nicht nur freudlos sein muss sondern auch liebe Erinnerungen wachrufen kann, haben uns Filme wie „Der Untergang“ vorgeführt, mit einem Führer, der nicht nur bös’ sondern auch endlich menschlich und sogar ein wenig bemitleidenswert gezeigt wurde, mit einer Führer-Sekretärin, die (wie wir wohl alle ?) doch auch eine große Bewunderung und heimliche Liebe für diesen männlichen Mann in ihrem Busen trug, eine Liebe, die doch so bitter enttäuscht wurde. Hätte Traudl Junge nur schon vor dem April 1945 gewusst, dass Hitler keine Juden mag, der Mann hätte wahrlich einen schweren Stand gehabt!
Als eine Mischung aus Traudl Junge und Leni Riefenstahl erscheint endlich mit dem Film „Hitlerkantate“ jetzt auch ein deutsches Mädel namens Ursula im Kanon der kollektiven Vergangenheitsbewältigung, welches dem Führer eine Kantate (aber eigentlich ihren jungen, burschikosen Leib) schenken will. Sie trägt einen Stahlhelm aus ultrablondem Haar, sieht auch sonst in ihren strengen weißen Klamotten ultrauncool aus und hat zunächst nichts Besseres im Sinn, als in Gegenwart des mit phallischen Handgrüßen inflationär herumfuchtelnden Quadratschnurrbarts in eine tiefe Ohnmacht zu stürzen. Dabei ist ihr eigentliches Problem der unvorhandene Vater und wahrscheinlich eine schmutzige Abtreibung, die sie wiederum der Fähigkeit beraubt hat, eine vorhandene deutsche Mutter werden zu dürfen. Verlobt ist sie mit einem ach zu harmlosen jungen Mann namens Gottlieb, der zwar erst frisch (Presseheft:) „bei der SS arbeitet“, aber dem hurtig nichts Geringeres als die Planung der (Film:) „stilvollen“ Erledigung des „Judenproblems“ anvertraut wird und der sich (Abgründe tun sich auf) doch heimlich auf ein Softerotikfilmchen mit der „Jüdin“ Gisela als Hauptdarstellerin einen von der Palme wedelt. Dabei war das schlüpfrige Filmchen eigentlich nur für einen guten, also militärischen, Zweck gedreht worden, nämlich für die Demoralisierung des kompletten Polenlandes. Heimlich soll der Streifen ins Land geschmuggelt werden, und dann wird der Pole schon sehen. Wer wixen muss, kann nicht schießen. Raffinierter Plan! Ausgerechnet SS-Gottlieb muss uns demonstrieren, wie todsicher das funktioniert. Wenn das nur Ursula wüsste.
Doch während Gottlieb in der ins trostlos Eisengraue zurechtdigitalisierten Reichshauptstadt hoffnungslos vor sich hin menschelt, beruft sie ihr Schicksal ins nordische, graugrüne Finnland zu Höherem. Die musisch Begabte soll Hanns Broch (Hilmar Thate), dem umstrittenen aber großen Komponisten, bei der Erstellung jener titelgebenden „Hitlerkantate“, einem Geschenk zum 50. Führergeburtstag („Sie wissen schon: mit allen verfügbaren Chören und illuminiert mit einem Lichtdom von Albert Speer“), assistieren. Ihr Lebenstraum Nummer Zwo, die sublimierte, die tonale Hitler-Hingabe, steht kurz vor der Verwirklichung, doch was ist das? Broch heißt nicht nur so ähnlich und sieht nicht nur so aus wie ein verkappter Bertolt Brecht, er ist auch einer. Undeutsche, schwarzgraue Borsten trägt er auf dem Schädel, dünne Zigarren im Mundwinkel, krause Gedanken im Kopf. Eine jüdische Freundin hat er auch. Kein Wunder, dass so einer früher mal Kommunist war. Nicht der Führer, nur die ihm für die Kantate versprochene Reputation im nazideutschen Kulturbetrieb bewegt ihn zum Komponieren.
Da muss Ursula aber ganz schnell eine arische Schnute ziehn und ihre sehnige Windhundstatur verkrampft zum Grammophon-Schubert auf dem Rentierfell zerdehnen, sodass es beim bolschewikischen Vaterlandsverräter schnackelt. Natürlich mit Erfolg, denn so schnell vergisst auch der verjudetste Deutsche die Schöße nicht, aus denen er einst kroch: das deutsche Lied, das deutsche Loch, das deutsche Glied, das deutsche Joch. Und Verdun war schmählich, schmutzig und schlammig. Schlamm, in dem er einst den besten Freund (rein zufällig auch Vater unserer Ursel) liegen lassen musste. Schlamm, der ja so viel schmutziger war, wundert er sich laut, als die schönen Reichsparteitage. Auch die deutschen Soldaten in Berlin sehen unter Hitler irgendwie straffer, ordentlicher, gepflegter aus als die halbtoten damals vor Verdun. Aber merkwürdig dieser kollektive Hang zum Untergang, darüber möchte Broch eine komplette Oper komponieren. Und er will, sagt er ihr deutlich, der Ursula den Hitler aus dem BDM-Leib vögeln. „Das kannst du gar nicht, er ist ganz tief in mir drin.“ So ihre Replik.
Ein Film mit Figuren, die an lauter Ambivalenzen leiden, bis sie stagnieren, bis der Film stagniert. Irgendwie hat dieser böse Hitler allen wohlmeinenden Deutschen die Fähigkeit zur Liebe geraubt und gegen einen ganz verrückten Sexus eingetauscht. So kann Broch Ursulas NS-Erotik nicht widerstehen, und gleichzeitig muss er leider das „hysterische Nazi-Flittchen“ verachten (was seine Geilheit natürlich nur steigert). So muss sie dem faltenreichen Charme des Maestro und Vaterersatzes erliegen, aber seine ewige Krittelei am Reich ist ihr unerträglich. Sie kann so nicht leben. Kann sie so sterben? Sie radelt mittenmang in den finnischen Weiher hinein. Ein dilletantischer Selbstmordversuch? Oder ist sie nur zu deutsch zum Radfahren? Wahrscheinlich hat sie es nur auf Unterkühlung, Fieber und Doktorspiele abgesehen, Nazischlampe, die! – und doch verwirrtes, armes Kind zugleich!
Ein Film über Demagogie, Sex und Hysterie im „3. Reich“. Und ein Versuch, die Gefühle von Nazis zu verstehen. Nazis, die eben doch keine richtigen Nazis waren, weil sie hin- und hergerissen, sprich: weil sie Opfer waren einer sexuell aufgeladenen Propagandamaschinerie. Alles nicht so schlimm, könnte man sagen, der Film tut ja selbst schon sein Bestes, um nicht ernst genommen zu werden. Der Skandal ist nur, dass er es ernst meint. Er zeigt Nazi-Aufmärsche und er zeigt den bellenden Hitler und er glaubt anscheinend wirklich, das alles sei sexy. Er zeigt ein naives BDM-Mädchen, bis zur Lächerlichkeit authentisch, und will uns davon überzeugen, dass ihrem stumpfen Ariergehabe etwas subtil Geheimnisvolles, eine magische Erotik innewohne.
Zunächst mal zur Erinnerung: Die Ästhetik des „3. Reichs“ ist eine Ästhetik für Arschlöcher. Punkt. Das war damals so und das ist heute so. Das haben auch damals schon einige gemerkt, aber komischerweise haben diese Hellseher Nazi-Deutschland entweder frühzeitig verlassen oder sie wurden von Nazi-Deutschland ermordet. Nur ein klein wenig Aufmerksamkeit und ein klein wenig Empathie der RestdeutschInnen hätte genügt, um Hitler zumindest unerotisch zu finden. Aber unsere Eltern und Großeltern fanden es in Ordnung, wenn die jüdischen Nachbarn abgeholt wurden, und sie machten, jeder auf seine Weise, dabei irgendwie mit, denn irgend jemand hat’s ja schließlich doch getan. Das mag schon tiefe seelische Schäden hervorrufen, speziell hinterher, wenn der Krieg verloren ist, hinterher, nach dem „Untergang“. Natürlich, die deutsche Nation kann einem schon ganz schön leid tun: All die unbeabsichtigten Orgasmen bei den Reichsparteitagen und beim Aufgeilen daran, zur Herrenrasse zu gehören, und hinterher die ekligen Leichenberge, die man nicht mehr schaffte, durch die Schornsteine zu entsorgen. Was für ein Gefühlsgefälle!
Daran wird auch nichts ändern eine von Regisseurin Brückner insinuierte (und für sie von Filmen wie „Der Untergang“ inspirierte) „education sentimentale“, wie sie sie in einem Artikel im „Freitag“ (vom 15.10.2004) beschreibt. Ihre Phantasie, die „Erstarrung im Trauma“ und die damit entstandenen Mythen über das 3. Reich mittels eines „erneuten Durchlebens“ zu durchbrechen. „Eine nationale, mit einem Trauma beladene Geschichte wirkt ähnlich wie eine individuelle traumatische Biografie“, schreibt Brückner. Das „gefühlte“ „3. Reich“ sei die mögliche neue Form einer Überwindung von „Trauma, Tabu, und Faszination“. Das Kino sei für diese Aufgabe „der privilegierte Ort“.
Die durch Brückner vom Kino eingeforderte Herstellung eines „distanzlosen Dabeiseins“ ist ja schon aufgrund der dem Spielfilm impliziten (und übrigens auch in der „Hitlerkantate“ deutlich durch Überstilisierungen vorangetriebenen) unvermeidbaren Fiktionalisierung von Geschichte und Handlung ein Ding der Unmöglichkeit (und eine Illusion, der z.B. auch oft die Rezeption des „Untergangs“ erlegen ist: „Endlich konnten wir Hitler erleben, wie er wirklich war“). Zum anderen erforderte diese Art der Rekonstruktion von „Geschichte zum Nacherleben“ (wäre sie überhaupt praktikabel) eine Eliminierung von über sechzig Jahren Rezeption und Bewusstsein der NS-Zeit. Verlangt also wäre Verblödung, um Verblendung zu verstehen. Gefühlt wurde auch unter den Verblendeten allerdings reichlich, aber nur in eine Richtung. Gedacht wurde weniger. Heute auch? Eine neuerliche Eins-zu-Eins-Empathie fürs Sentiment von Nazideutschland jedenfalls würde nicht über dieselbe Nazi-Blödheit hinaus gehen (und wenn die Seifenoperndiva Nazi-Ulla im Film tausendmal unerwartet schnell begreift, wie böse doch leider das Faszinierende am Faschistoiden ist).
Dass für Brückner nun auch ausgerechnet die hollywoodeske Serie „Holocaust“ und der im TV-Format gedrehte Film „Der Untergang“ Hilfen zu einer „tieferen Erkenntnis des Dritten Reiches“ darstellten, dass sie bei ihrer Aufzählung Filme wie der über achtstündige Dokumentarfilm „Shoah“ von Claude Lanzmann (ein Film, der bewusst versucht, jede Fiktionalisierung zu vermeiden, indem er nichts „nachstellt“, sondern lediglich Zeitzeugen über den Holocaust berichten lässt) und „100 Jahre Adolf Hitler – Die letzten Tage im Führerbunker“ von Christoph Schlingensief (ein Film, der bewusst und gezielt und höchst „emotional“ seine eigene Fiktionalität einsetzt, um Mythen und Tabus des „3. Reichs“ zu überzeichnen und durchbrechen) schlicht vergisst, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es Brückner womöglich weniger um eine künstlerische, der cineastischen Selbstbeschränkungen bewusste, Reflexion der Phänomenologie des „3. Reichs“ gegangen sein muss, sondern um etwas anderes. Nur um was denn eigentlich, wenn nicht um eine fragwürdige Reputation derer, die an sich schon unübersehbar fragwürdig waren?
Erkenntnis setzt Distanz voraus, sei es die Distanz durch künstlerische Überhöhung oder die Distanz durch Berichtetes, also etwa durch die Subjektivität der Überlebenden (und damit sind keine mit Musik aufemotionalisierte Interviews a lá Knopp gemeint). Nazi-Deutschland – und die „Hitlerkantate“ ist dafür nur ein weiterer Beweis – ist filmisch so wenig reproduzierbar wie die „Passion Christi“. Also erübrigt sich auch hier die naive Frage nach dem „Wie hat es sich angefühlt?“. Was uns vom „3. Reich“ bleibt, sind historische Daten, überlieferte Erfahrungen und z.B. seine Spiegelungen im Kino, das sich seiner Eigenschaft als Kunstform (also auch als „künstlicher“ Form) bewusst ist. Schlimm genug, wenn das Kino seine eigenen Mittel verkennt, aber in mir ruft es Übelkeit hervor, wenn es nicht nur behauptet, Authentizität herzustellen, sondern mittels derselben auch noch angetreten ist, die „deutsche Neurose“ zu kurieren.
Abgesehen davon, dass nun dieser Gefühls-Therapie-Film von Brückner den „Deutschen“ das Gleiche antut wie der Zahnarzt dem Patienten nach seiner Blendax-Prophylaxe („Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt“), schlage ich vor, jenen unheilbar arischen Deutschen, um die es dem Film ja vornehmlich zu gehen scheint, unbedingt ihre „Traumata“ zu erhalten – wenigstens etwas, woran sie zu knabbern haben – und dass wir (ja wir!) uns ganz gefühlsmäßig und empathisch und final bitte ab sofort nur noch dem Schicksal der Deutschen und der Europäer zuwenden, die während des „3. Reichs“ aufgrund ihrer „Rasse“, ihrer Religion oder ihrer Nationalität verfolgt oder ermordet wurden. Würden wir nämlich genau das tun, was unsere verbrecherischen Vorfahren im Faschismus tunlichst vermieden haben, müssten „wir Deutschen“ dieses ekelhaft selbstmitleidige „Trauma“, das doch immer nur nach einer Relativierung von Verantwortung riecht, wohl am schnellsten überwinden können, weil wir dann andeutungsweise ahnen würden, was ein echtes Problem ist und wer das echte Problem hatte. Um die (deutsche) Welt in Zukunft vor faschistoiden Tendenzen zu bewahren, ist es unbedingt angezeigt, nicht den Nazis nachzufühlen, sondern ihren Opfern. Wir waren darin schon einmal weiter als heute.