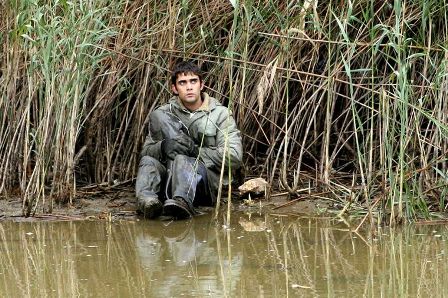„Frauen haben immer zu meinem moralischen Fortschritt beigetragen.“ (Jean-Louis)
Es stimmt: Die meisten der Filme Eric Rohmers sind zuallererst aus Wörtern, Sätzen, Aussagen, Reflexionen gemacht. Allein diesen Sätzen zu folgen ist Abend füllend, Kopf füllend, anregend – und mitunter auch anstrengend. Doch was wäre ein Film wie „Meine Nacht bei Maud“ ohne die Menschen, die diese Sätze sagen? Bestenfalls eine Philosophievorlesung der interessanteren Art. „Meine Nacht bei Maud“ ist deshalb nützlicher als jeder philosophische Rekurs, weil der Film das mit der Philosophie anstellt, was sie einzig und schließlich legitimiert. Er wendet sie auf die Praxis, also auf das Leben, an. Jede Figur rohmerscher Filme ist ein anderer ethischer Entwurf und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen sind Diskurse zwischen diesen Ethiken.
Frankreich, Clermont-Ferrand in der Zeit um Weihnachten bis Neujahr. Jean-Louis, ein Ingenieur von Anfang Dreißig, von Haus aus lascher Katholik mit einer sexuell nicht unbewegten Vergangenheit, hat sich irgendwann selbst zum gläubigen Katholiken konvertiert und denkt ans Heiraten. Auch eine dafür geeignete Kandidatin vermeint er gefunden zu haben, eine junge (blonde) Frau, die – wie er – regelmäßig am sonntäglichen katholischen Gottesdienst teilnimmt. Wie es aber der Zufall will, ergibt sich zunächst nicht die richtige Gelegenheit, in Kontakt zu kommen, mehr über sie zu erfahren. Stattdessen trifft er überraschend Vidal, einen alten Jugendfreund und Studienkollegen wieder, inzwischen ein Philosophie-Dozent, welcher ihn unbedingt einer (dunkelhaarigen) Freundin vorstellen will. Mit Maud, sagt er, verbinde ihn nicht viel, außer Sex, deshalb sei es nicht bedenklich, wenn Jean-Louis sie näher kennenlerne. Maud ist geschieden, Mutter eines kleinen Mädchens und Kinderärztin. Als sie Jean-Louis im Laufe eines langen, alkoholinspirierten und polemischen Abends zu Dritt deutliche Avancen macht, lässt Vidal die beiden allein – und wieder der Zufall, starker Schneefall, verhindert, dass Jean-Louis mit seinem Auto zurück nach Hause, in einen kleinen Nachbarort, fahren kann. Die attraktive Maud versucht ihn zu verführen, Jean-Louis widersteht ihr mit letzter Kraft, und wie von einem Zweifel befreit, kann er nun den Zufall, der am nächsten Tag zu einer Begegnung mit Françoise (Marie-Christine Barrault), der Blondine, führt, nutzen, um sich ihr vorzustellen und sich mit ihr zu verabreden. Zwei weitere (u.a. witterungsbedingte) Zufälle wollen es jedoch, dass er ihr schon vor ihrem Rendezvous begegnet und zwangsläufig auch bei ihr übernachten muss. Die Nacht bei Françoise ist in jeder Hinsicht das Gegenmodell zu der Nacht bei Maud. Wo dort zwar Sympathie, aber auch sinnliche Versuchung und Verführung dominierend waren, herrscht hier keusche Distanz, Respekt, die ehrlichen, hoffnungsvollen Absichten eines Heirats-Antrags und die Freiheit der Wahl statt der Manipulation durch die Triebe.
Diese zwei Prinzipien scheinen den ganzen Film zu prägen. Lohnt es, sich dem Reiz des Augenblicks, der zufälligen Begegnung hinzugeben – und so ein Leben von zufällig mehr oder minder passenden (wie man bei Maud erkennt, enttäuschenden) Liebesaffären zu leben, oder ist es besser, darauf zu warten (und daran zu glauben), dass einem der Mensch begegnen wird, der ideal zu einem passt. Wobei letzteres die Qualität der self fullfilling prophecy haben kann. Wenn sich zwei Menschen treffen, deren Ideal das der Zuversicht ist und die in den Sinn der Geschichte und des menschlichen Daseins vertrauen, so werden sie sich natürlich leicht gegenseitig in ihrer Einstellung bestätigen können. Durch ihre religiöse Antizipation eines großen positiven Sinnzusammenhangs schaffen sie bereits Sinn – egal, ob ihrer Religion ein existierender Gott zugrundeliegt oder nicht.
Rohmers vierter Film aus seinen sechs „Moralischen Erzählungen“ handelt zwar explizit von Religion und Glauben, lange Passagen bestehen aus Predigt und Gottesdienst, doch wie immer bei Rohmer ist es der Mensch, der sich seinen Gott oder seine Religion vorstellen oder aussuchen kann, der die Freiheit hat zu wählen zwischen der (antizipierten) moralfreien – was für ihn auch bedeutet: pessimistischen – Beliebigkeit der sozialen Beziehungen und dem Zutrauen in einen letzten Sinn des Daseins; Zutrauen, welches alles aufwertet: das Ich, das Du, das Miteinander.
„Mein Leben besteht aus Zufällen.“ Jean-Louis
Angesichts der Menschheitsgeschichte liegt natürlich der Zweifel an einem positiven Ausgang oder an einen positiven Fortschritt der menschlichen Rasse nahe. Genau dieses Problem steht im Zentrum von „Meine Nacht bei Maud“. Ein Katholik, ein Marxist und eine Nihilistin diskutieren die schlechthinnige Frage nach Moral: Wie sollen wir leben, und aus welchen Gründen sollten wir so leben, wie wir es beabsichtigen? Bindeglied zwischen den Extremen ist der materialistische Marxist Vidal, bezeichnenderweise er hat gelernt, dass gerade auch politische Arbeit nicht ohne ein metaphysisches und irrationales Element auskommt, das der Hoffnung auf den Sinn der Geschichte. Es ist kein Zufall, dass alle die Handlung (die Historie) vorantreibenden Begegnungen in „Meine Nacht bei Maud“ Zufallsbegegnungen sind und dass Jean-Louis’ und Vidals Gespräch im Restaurant den Zufall zum Thema hat, angefangen bei der Wahrscheinlichkeit, sich zufällig zu begegnen bis zur Wahrscheinlichkeit eines metaphysischen globalen Sinnzusammenhangs. Die Jugendfreunde haben sich das erste Mal nach Jahren in Clermont-Ferrand, dem Geburtsort des Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal, getroffen, und Pascal und seine „Wette, die besagt, dass man, und sei es gegen die Wahrscheinlichkeit, auf Gott setzen müsse, weil man eine solche Wette nur gewinnen könne“, sind es eigentlich, wovon der Film handelt:
Vidal:
“Gerade für einen Kommunisten ist dieser Text von der Wette ausserordentlich aktuell. Glaub mir: im Grunde zweifle ich, dass die Geschichte einen Sinn hat. Trotzdem setze ich auf die Geschichte – und ich bin in der pascalschen Situation. Hypothese A: das Gesellschaftsleben, jede politische Aktion haben keinerlei Sinn. Hypothese B: die Geschichte hat einen Sinn. Ich bin ganz und gar nicht sicher, dass Hypothese B eher zutrifft als Hypothese A. Ich würde eher das Gegenteil behaupten. Nehmen wir an, dass für Hypothese B eine Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent besteht und für Hypothese A neunzig Prozent. Jetzt pass auf. Aber trotzdem, ich kann nicht darauf verzichten. Ich muss auf sie setzen, auf Hypothese B. Denn sie gibt der Geschichte einen Sinn, denn sie ist die einzige, die mir ermöglicht zu leben. Nehmen wir an, ich habe auf Hypothese A gewettet und Hypothese B stellt sich als wahr heraus, trotz der zehn Prozent Wahrscheinlichkeit, dann hab ich mein Leben völlig verloren. Also muss ich mich entscheiden, für Hypothese B, denn sie ist die einzige, die mein Leben rechtfertigt. Natürlich spricht eine Wahrscheinlichkeit von neunzig Prozent dafür, dass ich mich irre. Aber das ist unwichtig. – So etwas nennt man mathematische Hoffnung. Das heisst: der Gewinn wächst mit der Wahrscheinlichkeit. Und was deine Hypothese B betrifft, mag die Wahrscheinlichkeit vielleicht gering sein. Aber der Gewinn ist unermesslich. Denn für dich ist er ja der Sinn des Lebens und für Pascal der Gewinn des Unendlichen.“
Der strenggläubige Katholik Jean-Louis bleibt skeptisch, und sein Rest von Skeptizismus trennt ihn von dem, was Pascal die „subjektive mystische Erfahrung“ nennen würde. Durch Vidal aber wird sein Glaube mit seinen eigenen Vorbehalten und mit Maud, dem rationalistisch-atheistischen, sehr physischen Vorbehalt in Person konfrontiert und auf die Probe gestellt. Seine Nacht bei Maud schließlich ist der Katalysator, der ihm seine unbedingte Entscheidung für Hypothese B (Die blonde Katholikin) ermöglicht.
Am Ende besteht alles aus Zufällen, Zufälle, die sinnvoll geworden sind, weil Jean-Louis ihnen Sinnhaftigkeit beimisst, d.h. weil er ihrer Abfolge eine zugrundeliegende Ordnung unterstellt. Weil er aufgehört hat, sich ihnen zu verschließen, weil sie für ihn bedeutungsvoll sind, haben sie Offenbarungscharakter, haben sie für ihn etwas Mystisches. Oder auch: Weil sie immer schon mystisch waren, kann er die Zufälle als mystisch begreifen, seit er aufgehört hat, nur mit seinem Verstand zu glauben. Glaube und Hoffnung, d.h. ein glückliches Leben funktionieren so nur wider die Vernunft.
„Wie die Sittlichkeit eine Sache der Empfindung, nicht des Denkens ist, so ist Gott, so sind selbst die ersten Grundsätze, auf denen die Gewissheit der Beweise beruht, ein Gegenstand nicht der Vernunft, sondern des Herzens.' Blaise Pascal
„Ich glaube nicht an Kausalität, ich suche nicht nach Gründen. Es stört mich, wenn gesagt wird: diese Tatsache hat einen Grund. Warum sollte sie einen haben? Warum muss man unbedingt nach Gründen suchen? Das zwingt einen, eine Erklärung zu finden. Ich sehe das anders. Ich verstehe es eher so, dass die Dinge einem Ziel zustreben. Wie in einer Geschichte. Die Welt hat einen Sinn. Eine solche Erklärung ist theologischer. Gerade der Film entzieht sich menschlicher Kausalität, weil uns der Film an die Natur verweist, an eine organisierte Natur, die auf ein Ziel gerichtet ist. In diesem Fall ist der Mensch nicht der absolute Herrscher über sein Material. Sein Material bewegt sich in eine bestimmte Richtung, und er hat sich in diese Richtung treiben zu lassen.“ Eric Rohmer
„Meine Nacht bei Maud“ verrät viel über Rohmer und seine Philosophie des Zutrauens in den Gang der Geschichte. Aber im Film verbirgt sich offenbar auch ein unreflektiertes, konservativ wirkendes Menschen- speziell Frauenbild. Dass die sinnliche und verführerische Maud schwarzhaarig, die ideale Ehefrau dagegen katholisch, eher ätherisch als erotisch und blond sein muss, mag von Rohmer zwar schon bewusst so inszeniert worden sein. Eine notwendige Distanz zu althergebrachten, typisch männlichen, restriktiven und sexualfeindlichen Moralvorstellungen von der Frau als der Heiligen oder der Hure stellt er im Film aber nicht her.
So wenig Rohmer sich auch in seinen Filmen ums tagespolitische Geschäft kümmert, der Zeitgeist vom Pariser Mai 1968 steckt in der Figur des Vidal und der Aufbruch einer neuen feministischen Bewegung wird durch Maud verkörpert. Maud steht in jeder Eigenschaft für die zum Ende der sechziger Jahre ausgerufene Emanzipation der Frau, sie ist nonkonformistisch, sie hat sich von ihrem Mann scheiden lassen, ist alleinerziehend und berufstätig, und sie sucht sich ihre Liebhaber lieber selbst aus, statt auf sie zu warten und sich ihnen hinzugeben. Sie bedroht anscheinend nicht nur den Katholiken, sondern auch den Mann in seiner Autorität, indem sie für sich die gleichen Rechte wie die der Männer geltend macht, sie gefährdet das Patriarchat, das Jean-Louis trotz seiner zur Schau gestellten Toleranz repräsentiert und praktiziert. Fakt ist, selbst wenn Maud prinzipiell in den Augen von Jean-Louis Recht hätte, selbst wenn sie wirklich die interessantere Frau wäre für Jean-Louis – es wäre ihm unmöglich, sie zu erwählen, weil sie ihn mit ihrer offensiven und autonomen Weiblichkeit zutiefst verunsichert.
Schließlich ist es dann auch er als Mann, der sich für Françoise entscheidet (ein selbstherrlicher Akt, lange bevor er sie überhaupt kennt), dabei ziemlich uncharmant und aufdringlich vorgeht, und nicht umgekehrt. Mit Françoise stimmt seine konservative Ordnung wieder. Der Mann erwählt und er entscheidet und umso rechtmäßiger ist die Entscheidung des Mannes, wenn er Gott (den Sinn der organisierten Natur) auf seiner Seite wissen darf. Françoise spielt im Film eine ziemlich untergeordnete Rolle. Doch, auch Françoise hatte früher einen Geliebten, im Gegensatz zu Maud aber bereut sie es und bezeichnet es als Sünde. Wenn dagegen Jean-Louis von seinen Affären spricht, dann mit einem jovial-chauvinistischen Unterton: Kavaliersdelikte insgesamt. Für beide aber gilt offiziell und wohldeklariert, d.h. von Rohmer leider wenig gebrochen: Sie haben ihre (Erb-)Sünden erkannt, haben bereut und können auf Vergebung hoffen.
„Ich glaube, es hat dich in meinem Leben immer gegeben.“ Jean-Louis
„Und ich glaube, da täuschst du dich.“ Françoise
Bezeichnend dann der Schluss: Jahre später, Jean Louis und Françoise mit ihrem kleinen Kind begegnen Maud (natürlich zufällig) im Urlaub am Meer. Das Paar sieht glücklich aus, sie haben ihr Kind bei sich: das Produkt, das sichtbare Zeichen, der „Gnade“, während Maud nun ganz allein ist. Mauds neue Ehe ist unglücklich und selbst ihre Tochter ist offenbar nicht mehr bei ihr – jedenfalls fällt kein Wort über die Tochter und in der Szene fehlt sie. Man braucht kein Chauvinist zu sein, um zu denken, dass die Ehe zwischen Jean-Louis und Françoise nur deshalb so gut klappt, weil sich die Ehefrau zurücknahm, keine hohen eigenen Ansprüche stellte, um zu wetten, dass sie zum „Wohl der Familie“ auf den Beruf verzichtete, und leider könnte man geneigt sein zu schließen, dass es sich Maud nur deshalb immer mit allem (der Welt Gottes) und vor allem mit allen (den Männern) verscherzt, weil sie sich ihnen verdammt-noch-mal nicht unterordnen will.
Die schicksalhafte Fügung, so der Tenor, lässt keinen aus. Das Glück winkt denen, die sich dem Schicksal anvertrauen; das Unglück ist mit den Zweiflern und denen, die eher an sich, als an das „Gute“ glauben. Besonders hart trifft das Unglück die emanzipierte Frau. Wahrscheinlich wird ihr Schicksal vorrangig begründet in der „organisierten“ Natur der etablierten Geschlechterverhältnisse.
Oder man wechselt kurz die Perspektive und blickt auf den verbürgerlichten Jean Louis, der sich ewig ärgern wird, diese eine Gelegenheit ausgelassen zu haben.