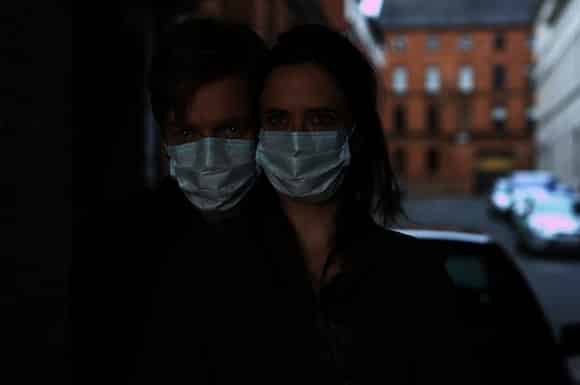Zu Fragen der Tradition, Ethik und Sichtbarkeit in Steven Spielbergs 'War Horse – Gefährten'
Angesichts von ,,War Horse – Gefährten', Steven Spielbergs Zweieinhalbstundenepos über die Liebe eines britischen Bauernbuben zu seinem Pferd in den Wirren des Ersten Weltkriegs, besteht einerseits die Möglichkeit, sich über all den Kitsch zu ärgern oder auch lustig zu machen; anderseits gibt es die Option, darüber zu jubeln, dass hier das Herz ungeniert regiert. Von beiden Möglichkeiten wird im journalistischen Diskurs ausgiebig Gebrauch gemacht. Was aber, fragt es sich aus Skepsis gegenüber dieser Entgegensetzung, ist so schlimm an der Rührung oder so schlecht am Denken? Eine dritte Alternative – die beherzigt, dass Rührung, so sie nicht dumpf sein will, immer auch Hirnsache ist –, ein vielleicht sinn- und reizvollerer Zugang zeichnet sich ab, wenn man versucht, dem zu folgen, was 'War Horse' an Auseinandersetzung bietet; davon ist vielleicht mehr da als von jenen triefenden Erfüllungen, gar Übererfüllungen, die den Film ganz zu dominieren scheinen. Die schlicht (oder schlichtweg reaktionär) anmutende Adaption eines Kinderbuchs von Michael Morpurgo entfaltet insbesondere ein breites Spektrum an Wendungen des Konzepts Tradition; das geschieht mal auf komplexe, mal auf prätentiöse Art, reich an inneren Spannungen.
Tradition ist zunächst die ländliche Welt des versoffenen, verbitterten Kleinbauern-Vaters (Peter Mullan) wie auch des fiesen Grundbesitzers (David Thewlis), der ihn auspresst. Setzt sich schon der Vater einen verhängnisvollen, später bereuten Moment lang über gute Sitte und ökonomische Vernunft hinweg, indem er seinem Grundherren und Gläubiger bei einer Versteigerung ein für die Landwirtschaft viel zu heißblütiges Prachtpferd vor der Nase wegbietet, so bricht sein Sohn Albert (Jeremy Irvine) vollends mit den Gepflogenheiten, und zwar indem er pflügt: Er beharrt darauf, den nunmehr Joey getauften Hengst, zu dem ihn eine innige Liebe verbindet, zu behalten, obwohl dessen Verkauf zwecks Erhalt der Pachtfarm dringend geboten wäre, und um das Pferd zu behalten, muss er beweisen, dass es sich – entgegen aller Programmatik der Biologie (des 'Blutes') und des bäuerlichen Brauchs – zum Pflügen des harten Bodens eignet.
Um die ineinandergeschachtelten hürdenförmigen Bedingungszusammenhänge und Deadline-Strukturen dieser zugespitzten Situation – Kann Albert mit Joey den steinigen Hang pflügen oder nicht? – auf die Spitze zu treiben, lässt der Film diese Prüfung unter den Augen von Alberts Eltern, sowie des Grundbesitzers und der halben Landkreisbevölkerung stattfinden – noch dazu bei Einbruch eines starken Unwetters . Die ebenso penetrante wie facettenreiche neoklassische Manier, in der Spielbergs Inszenierung generell in 'War Horse' Wetterstimmungen, Himmels- und Lichttönungen in die Bedeutungsregister des Geschehens einspeist, wäre ein Thema für sich. Noch prägnanter ist jedoch der Status der Pflugszene, bei der Joey vorne zieht und Albert im Pfluggeschirr hinten nach schiebt, beide verbunden im Gang an die Grenze zur Erschöpfung, als Eröffnung einer Reihe: Mit ihr beginnt – nach einigen Auftakten zuvor – eine Serie von verdichteten Schlüsselmomenten der Bewährung angesichts vorgegebener Hindernisse, Aufgaben, Fristen (so folgt etwa alsbald ein als Pferderennen gestaltetes Kavalleriemanöver). So etwas ist nun erstens eine wohlvertraute, erzklassische, traditionelle Erzählbauweise im insbesondere US-amerikanischen Mainstream-Kino. Zweitens ist der ,,Du schaffst es!'-Spirit, den die betreffenden Szenen in 'War Horse' versprühen (in Verbund zumal mit John Williams‘ flächendeckendem Score), hier mit dem Motiv des Traditionsbruchs kurzgeschlossen – ein liberales Modernisierungsmotiv, das wir als ebenfalls Hollywood-klassisch oder auch als neoliberal-flexibilistisch verbuchen können: etwa wenn später im Film, in Frankreich, ein Mädchen, das zum Reiten zu jung aber zum Bravsein zu forsch ist, sich das Pferd durch Sprungübungen und kühnes Ausreiten zu eigen macht, unter den halb skeptischen, halb stolzen Blicken ihres Großvaters. Spielbergs Szenen pferdig-erdiger Selbstbehauptung vollziehen sich meist unter den Augen von in close-ups einmontierten, fassungslos bis begeistert kopfschüttelnden Zusehenden.
Von der Kavallerie zum Kalvarienberg
Ausgehend und weggehend von solcher Ideologie und Jubelästhetik einer Feier von 'Hochleistungsbereitschaft' zeichnet sich drittens ein Übergang ab: Von eben diesen Szenen, ins Filmspektakel integrierten Spektakeln, geht immer mehr ein appellatives Moment aus, das das Zuschauen ethisch fordert, auffordert – zum Mitleid seitens des Filmpublikums, zum engagierten Eingreifen seitens der Filmfiguren. Dies nun insbesondere insofern, als viertens die (neo)liberalen 'Leistungstest'-Szenen in die Bildlichkeit einer anderen Tradition übergehen bzw. sie als deren virtuelles Moment hervorkehren, nämlich in die des Kreuzwegs: Ein Hauch von Golgatha tritt schon am leidvollen Pflügen auf dem Hügel hervor; vollends akut wird die christliche Ikonografie, wenn Joey und andere Gäule, mit drückendem Geschirr behängt, riesige Kanonen eine Anhöhe hoch ziehen, immer wieder unter der Last zusammenbrechend; oder wenn dieses eine Pferd unter vielen an der Front verwerteten sich am Ende als auserwähltes, nachgerade gesalbtes Tier erweist, dessen Stirnmal inmitten aller Wunden freigelegt wird, in einem Offenbarungsmoment, der von ritueller Waschung ebensoviel an sich hat wie vom neutestamentarischen Sujet des ungläubigen Thomas, der im emphatischen Sinn glaubt, als er 'sieht'.
Die genannte Szene steht am Ende einer Serie von Momenten, in denen unverblümt bekräftigt wird, dass es sich bei diesem Pferd um ein 'ganz besonderes' handelt (was insofern redundant anmutet, als der Film ja nach seinem tierischen Held betitelt ist und dieser, mehr als sein menschlicher 'Gefährte' schon das Plakatmotiv prägt), und vor allem am Ende des Ersten Weltkriegs. In diesen muss Joey ziehen, und er geht im Krieg – nahe oder direkt an der Front in Frankreich, eine Zeit lang in Begleitung eines zweiten Pferdes, mit dem er sich angefreundet hat – von Hand zu Hand. Ein britischer Kavallerie-Captain (Tom Hiddleston), der Joey dem Vater abkauft, bevor Albert das verhindern kann, zwei junge deutsche Deserteure, das bereits genannte französische Mädchen (Celine Buckens), ein gutherziger deutscher Heeres-Pferdepfleger, sie alle verbringen jeweils einige Zeit mit Joey. Die Erzählung, an der diese Begegnungen aufgefädelt sind, macht nach zwei Dritteln einen Zeitsprung von einem noch naiven Zustand zu Kriegsbeginn 1914 zur illusionslosen, infernalischen Endphase des Grabenkrieges im Herbst 1918 und ist gerahmt von zwei dramatischen Auktionsszenen, in denen Joey jeweils in die Hand eines Vaters bzw. Großvaters und aus dieser Hand erstmalig bzw. endgültig wieder in Alberts Arme gelangt.
Entlang dieses Plots fungiert das Konzept Tradition im Sinn einer steten Weitergabe, die mehr von Ausstreuung und Entortung denn von Stabilisierung an sich hat und anhand derer Spielberg eine Utopie verfolgt, die er am nachdrücklichsten in 'Schindler’s List' (1994) formuliert hat: die Utopie, dass an der Verdinglichung, an der Logik der Abstraktion und Austauschbarkeit, die (transhistorisch) der Bann der Repräsentation und (universalhistorisch) die kapitalistische Waren- und Tauschökonomie dem Leben auferlegen, ein rettendes ethisches Moment hervortreten könnte; dass das Austauschen-gegen in ein Preisgeben-für umschlagen könnte – etwa in Szenen der Selbstaufopferung. So tritt Joey etwa freiwillig an die Stelle eines völlig erschöpften Pferdes in die Reihe der zum Kanonentransport vernutzten Zugtiere. Ein Pferd, das sich opfert, das ist hier als (Ausnahme-)Fall von Erwachen eines ethischen Bewusstseins dort, wo keines vorgesehen ist, gesetzt, mitten im blinden Vollzug des physischen Überlebens nämlich, und dieses Erwachen hat ein vielleicht kaum weniger wundersames Gegenstück unter den Menschen, wenn gegen Ende ein britischer und ein deutscher Soldat im Niemandsland zwischen den Schützengräben jeweils ihr Leben riskieren, um Joey aus dem Stacheldraht zu befreien. Dass in 'War Horse' die meisten Weitergaben des Pferdes durch im besten Sinn haarsträubende Wendungen der Erzählung erfolgen und so die Regeln der Wahrscheinlichkeit immer schon einem höheren Walten unterworfen scheinen, das steckt den Horizont ab, in dem sich solche Akte vollziehen können; sie erscheinen dann gleichermaßen als messianische Interventionen der 'einen gerechten Tat' in einen unheilvollen Lauf der Geschichte wie auch als Formen einer Solidarität, die insofern Schwundformen und am Rand des Sozialen, vielleicht sogar 'asozial' bleiben, als sie sich auf gesellschaftlich unqualifiziertes tierisches Leben beziehen.
Wimpy Wimpel
Im Zeichen der Wendung zu Joey als zoé, zum Pferd als Inkarnation einer universalistischen Ethik des 'bloßen Lebens', gibt Spielberg den Ersten Weltkrieg als Initialmoment der Stiftung einer neuen Tradition zu verstehen: Der Krieg, der das Brauchtum und den Habitus der Reiter als Ritter im Maschinengewehrfeuer schlagartig hinfällig macht – in einer Kriegsszene reihenweisen Hinfallens, die in sich selbst noch eine überraschende Wendung nimmt –, dieser Krieg wird zur Chance, dass Albert nicht nur das geliebte Pferd zurückzugewinnt, sondern auch jenen Stolz, der seinem verbitterten Vater abhanden gekommen ist. Zur Chance wird der Krieg allerdings nicht direkt, sondern über zwei Umwege.
Zum Einen muss hier Alberts Mutter (Emily Watson) als Mittlerin einer Weitergabe fungieren, die zwischen Vater und Sohn nicht mehr gelingt: Sie gibt Albert einen Armeewimpel, den der Vater – nebst einem Hinkebein – aus dem Burenkrieg in Südafrika mitgebracht und in einer Kiste versteckt hat. Mutters Appell an Albert, er möge seine Träume nicht aufgeben und sich so jenes Vermächtnisses würdig erweisen, zu dem der seines Stolzes verlustige Vater selbst nicht mehr steht, dieser Auftrag trägt Züge jenes 'Earn this!', das der von Tom Hanks gespielte, ein mütterliches Fürsorge-Ethos umsetzender Ersatz-Vater am Ende von Spielbergs 'Saving Private Ryan' der Titelfigur mit auf den Lebensweg gegeben hat. (Wie sich Alberts Mutter, die an Vaters Vermächtnis appelliert, zur ebenfalls bäuerlichen Mutter Ryan verhält, die in Spielbergs Film von 1998 nur eine Szene lang von hinten und im Zusammenbruch über die Nachricht vom Tod dreier Söhne zu sehen war, wäre an anderer Stelle auszuführen.)
Vaters alter Armeewimpel, ein bedruckter, mit Tradition imprägnierter Fetzen bunten Stoffs, geht zusammen mit Joey durch den Krieg und die Prozession der Weitergabe und übernimmt ein Stück weit die Rolle der schon recht zerfetzten amerikanischen Fahne in der Friedhofsrahmenhandlung am Beginn und Ende von 'Saving Private Ryan'. Dass allerdings die nationale Fahne in der Schlusseinstellung dieses (ebenso de- wie rekonstruktiv angelegten) World War II combat movie wieder Objekt einer pathetischen Gruß- und Ehrerbietungsgeste sein konnte, verdankte sich einem Dreh, einer Wendung analog jener, die sich auch in 'War Horse' während des gesamten Erzählverlaufs vollzieht. Das ist der zweite Umweg, durch den Krieg zur Chance einer Neugründung wird, fast ein Selbstwiderspruch des Krieges: Die traditionelle nationalheldische Tugend des Mutes wird postheroisch umdefiniert, in Richtung der genannten Bekundungen von Empathie und Stellvertretungs-Selbstopfer – verbunden mit einer empfindsamen Zartheit im männlichen Auftreten (wie sie Jeremy Irvine als Albert oder Tom Hiddleston als Kavallerie-Captain anrührend spielen); und der Krieg als nationalstaatlich definiertes, industriell routiniertes obsessives Massentöten wird hier im Bild umgewendet zur Initialerfahrung eines Projekts der Rettung, das sich ebenfalls obsessiv, vielköpfig und -förmig vollzieht, allerdings in Akten gerade des Routinebruchs und des Absehens von lokal und national tradierten Identitätsmustern, und das sich auf das Kreatürliche schlechthin richtet, ultimativ verkörpert in Joey.
Hier werden zwei Probleme virulent. Der Vorwurf, dass Spielberg ein Ethos und ein säkular-messianisches Geschichtsbild der Rettung allzu pauschal einer Ideologie 'humanitärer Kriegsführung' und US-amerikanischer Interventions- oder Rechtsdurchsetzungspolitik mit militärischen Gewaltmitteln anheimzustellen bereit ist, dieser Vorwurf geht an 'War Horse' nicht vorbei; mit noch mehr Dringlichkeit ließ er sich gegenüber 'Saving Private Ryan' formulieren. Das ist das eine Problem. Das andere betrifft die Beschränkungen, die Spielberg hier wie auch schon in 'Saving Private Ryan' seinem Konzept der Rettung durch Weitergabe auferlegt. Er unterstellt nämlich, dass die Rettung doch durch eine Eigenschaft des zu rettenden Lebens verdient sein will, dass sie also nicht in messianischer, ethisch radikaler 'Beliebigkeit' erfolgt (um eine weitere Chiffre aus dem Inventar der Geschichtsapokalyptik und Rettungsethik von Giorgio Agamben zu strapazieren), sondern: In dem Tier, das sich wiehernd und zuckend im Geschirr aus Holz und Gestrüpp aus Stacheldraht verfängt (so wie die menschlichen Massen im kriegerischen Gestell aus Uniformen und Ledergurten bis hin zu Gasmasken und Brustpanzern aus Metall – Erscheinungsbilder, die in der Ausstattung und Ikonografie des Films stark betont sind), in diesem leidenden bloßen Leben lässt Spielberg uns eine Christus-artige Figur sehen, was möglich wird, weil dieses Tier nicht eine anzuerkennende, unhintergehbare Gewöhnlichkeit und Alltäglichkeit verkörpert, sondern eben etwas Besonderes ist – nicht im Sinn einer Singularität, die (wie die Liebe) keiner Begründung ihrer Besonderung bedürfte, sondern eben 'tatsächlich', weil Joey so stark, schnell, schön etc. ist und überdies mit allerlei Erbaulichkeiten assoziiert, die der Film uns kredenzt.
Dieses Zurückscheuen (um ein Pferdesinnbild zu gebrauchen) vor einer radikalen Beliebigkeit – einer, der Spielberg in anderen seiner filmischen Rettungsprojekte näher und treuer gewesen ist –, es geht in 'War Horse' einher mit Momenten der offenbar ungeprüften, unkritischen Übernahme von Bild-Traditionen, die sich zu Klischees verfestigen. Das gilt für die christlich überlieferten Bilder in diesem Film und mehr noch für andere: Die Begegnung der Kriegsgegner zwischen den Gräben, hier nicht um Weihnachten 1914 zu feiern, sondern um 1918 ein Pferd zu retten, diese sich als Wunder aufspielende Anekdote ist als Teil einer stumpf gewordenen Menschlichkeit-im-Krieg-Folklore wenig mehr als ein Klischee. Und da ist die Art, in der die Einführung des französischen Mädchens und seines Großvaters das (in den Südengland-Sequenzen bereits angeklungene) Beschwören bukolischer Idyllik auf die Spitze treibt: Mit dem silberhaarigen grand-père, ausgerechnet Marmeladenmacher von Beruf, und der entzückend gemeinten Göre, die gleich einmal mit einem Topf frischer Erdbeeren in ihrer gemütlichen, charmant vollgeräumten Bauernstube ins Bild kommen, fühlt man sich fast in eine Episode zwischen der kecken Heidi und dem gutmütigen Almöhi versetzt, wäre nicht die Anmutung eines Werbespots für französischen Landkäse aus den 1980er Jahren noch stärker. Ja, schön ist die Welt, in die ein so schönes Pferd mit so kräftiger Mähne gehört. (Das Mädchen und der am Ende allein übriggebliebene Großvater zeichnet der Film ja als die moralisch am meisten legitimen Anwärter_innen auf den Besitztitel an dem – ureigentlich zu Albert gehörenden – Pferd, umso mehr als grand-père aus dem salomonischen Dialog mit Albert nach der finalen Auktionsszene mit einer Geste großmütigen Verzichts auf das Tier hervorgeht; gerade der Verzicht jedoch, so wird deutlich, kann ihm die ersehnte Erinnerung an seine Enkelin wiedergeben.) Dass 'War Horse' eine Sensibilität mit bedient, die auf die Präsenz von Ponypuppen und Pferdepostern in Kinderzimmern hinausläuft, ist zunächst unter Chiffren wie 'Familienfilm', 'Kernzielgruppenmarketing' und 'Dauerauswertung qua Merchandising' subsumierbar (und sieht immer wieder auch genauso aus).
Wer ein einziges Pferdeleben rettet, rettet die ganze Welt.
Spielbergs Inszenierung, seine ästhetische Ausformung des rettungsethischen Programms, gibt also vor, uns jene hohen Werte der Güte und Schönheit und jene nahezu paradiesischen, jedenfalls aber idyllischen und unberührten Welten, die der Rettung wert sind, wirklich zeigen zu können. Das unterscheidet seinen Zugang zur Rettung des Tiers wesentlich von einem Klassiker des Kreatur-Kinos, der im Zusammenhang mit 'War Horse' oft genannt wird, nämlich Robert Bressons 'Au hasard Balthazar' (1965). In diesem Film war es ein Esel, der von Hand zu Hand geht und leidet, ebenso unverdient wie unsere Anteilnahme an ihm, soll heißen: Weit entfernt von der Idee, Balthazars Anblick könnte ein Faible für das Aufhängen von Eselspostern inspirieren, spannte Bressons Film eine unvermittelte Konstellation auf zwischen dem bewusstlosen Tierkörper (Bressons erklärtermaßen bestes 'Modell') und unserem empathetischen Blick auf ihn; und dieser Blick kann immer nur eine Projektion sein, der nichts Gegebenes, Begründendes entspricht und die darin – in den 'traurig' erscheinenden Eselsaugen – ihr Gegenüber findet; in etwa dies wurde oft als Bressons Idee christlicher 'Gnade' bezeichnet (und mit einer Salbung des neugeborenen Eseleins beginnt ja der Balthazar-Film).
Zu solcher Wendung zu einem beliebigen Leben schwingt sich 'War Horse', wie gesagt, nicht auf. Der Film erzählt, vielmehr: prozessiert, die Weitergabe eines Dings, eines verdinglichten Lebens, dessen Seele in unserer anteilnehmenden Wahrnehmung ruhen könnte, sofern dieses Zusehen nicht mit 'zuvorkommenden' Versprechungen eines Sehens-Werts überhäuft und dadurch blockiert wird – was aber eben in 'War Horse' geschieht (ein so schönes Pferd hat es eben verdient, dass wir ihm mitfühlend zusehen). Und daher fällt dieser Film etwa auch ab gemessen am Maßstab von Spielbergs 'A.I. – Artificial Intelligence' (2001) – jenem Stationenlaufmärchen rund um einen seelenlosen mechanischen Buben, das seiner dekonstruktivistischen tagline 'His love is real, but he is not' treu blieb (während 'War Horse' eher ein Programm 'Their love is real, because they are real[ly beautiful]' vorführt). Und man könnte da auch den im japanisch besetzten Shanghai spielenden Stationenlauf eines verwirrten Buben durch Krieg, Lager und Überleben im Medium von buying and selling in 'Empire of the Sun' (1987) nennen, um einen weiteren wenig geschätzten Spielberg-Film zum sozusagen werk- und projektimmanenten Vergleich heranzuziehen. Letztere Art von Vergleich scheint jedenfalls ergiebiger als wenn man, angestoßen durch die Ähnlichkeit von Bildern 'War Horse' als 'Anti-Kriegsfilm' an Kubricks 'Paths of Glory' (1957) messen wollte oder Spielbergs englische Landschaft, samt 'Kultivierung' eines 'Heims', an der irischen von Fords 'The Quiet Man' (1952). Dieser Ford-Vergleich liegt ja auch deshalb einen Moment lang nahe, weil die telepathische Kraft der Zuneigung, die das nichtmenschliche Wesen und den Menschenknaben so eng verbindet wie die Liebe zwischen Joey und Albert, in Spielbergs 'E.T. – The Extraterrestrial' (1982) just anhand eines Ausschnitts aus 'The Quiet Man' (und dessen re-enactment in der Filmhandlung) hervortritt. Aber 'War Horse' ist kein Film, der mit John Wayne denkbar wäre, auch dann nicht, wenn seine deutsche Synchronfassung 'Schlachtross' hieße, und die Ford’schen Wolkenhimmel münden ja bei Spielberg schlussendlich in das – seine Unechtheit breit ausstellende – Klischeebild der wiedervereinigten Familie vor dem roten Studiohimmel, der in Richtung 'Gone With the Wind' (1939) weist.
Neben dem musealen, restaurativen Gestus, mit dem 'War Horse' sich zur filmhistorischen Tradition Hollywoods stellt, reiht der Film sich eben auch in die Spielberg’sche Überlieferung ein, und die gilt insbesondere dem Versprechen einer Rettung durch Bild-Werdung – durch eine Verbildlichung, die filmisch ist, indem sie eben gerade nicht 'alles' zeigt, sondern auswählt, aus- und abblendet, das zu Zeigende herauslöst aus einem Unsichtbaren, das als Impliziertes mit zum Bild gehört. Spielberg, in dessen Film- und Fernseharbeiten der Zweite Weltkrieg in verschiedensten Formen und Registern dauerpräsent ist, hat mit 'War Horse' zum ersten Mal einen im Ersten Weltkrieg spielenden Film gedreht; dies im Vorfeld des neuen geschichtsschlüsselhaften Status, den dieser Krieg durch den 2014 anstehenden hundertsten Jahrestag seines Beginns mit geschichtsmedienkultureller Unweigerlichkeit wiedergewinnen wird (und übrigens zeitgleich mit zwei Arbeiten von Martin Scorsese, in denen der Ersten Weltkrieg als Einbruch traumatisierender Geschichte gegen die Glücks- und Lichtversprechen des Entertainment im Allgemeinen und des Kinos im Besonderen gesetzt ist: die Referenzen auf nachlastende, unaussprechliche Schrecken des Grabenkrieges als Fremdkörper in der Glamourstadt zu Beginn der Serie 'Boardwalk Empire'; die Rivalität zwischen dem Wunderwerk des fühen Kinos und der toten Mechanik des Krieges und der rationalisierten Wirtschaft, verdichtet im quasiprothetischen Doppelmotiv Damenschuhabsatz und Beinschiene in “Hugo”).
Spielbergs Erster Weltkrieg ist – bei aller Aufmerksamkeit auf Handlungs- und Ausstattungsdetails des Grabenkampfes – ein versetzter Zweiter, der wiederum über den Ereigniskern der nationalsozialistischen Massenmorde definiert ist. Der moderne industrialisierte Krieg erscheint hier vor allem als eine totalisierende Gewalt, die die Welt in Totaleinstellungen fasst, als ein Panoptismus, der es mit der Immensität der Landschaft selbst aufnimmt und deren majestätischen Anblick (in den endlosen Hügelweiten Südenglands) durch Panoramen zerfurchter oder mit Leichen übersäter Erde ersetzt. Die Vogelschau auf die vom britischen Kavallerieangriff zurückbleibenden Toten (Menschen und Pferde) könnte aus 'Saving Private Ryan' stammen, ebenso die beiden Szenen, die deutsches Maschinengewehrfeuer vorführen (close-up des Laufs bzw. Totale einer MG-Stellung von unten). Gegenüber der am Vorbild des MGs ausgerichteten Optik, die alles 'erfasst', ist das rettende Bild intim mit dem Nicht-Sehen und Abschatten. Das beginnt beim Thema des Versteckens: Wenn das französische Mädchen die beiden Pferde vor den die Farm durchsuchenden deutschen Besatzungstruppen in einer Dachkammer versteckt, um sie vor jener 'Vernichtung durch Arbeit' zu bewahren, der das eine Tier später doch zum Opfer fällt, dann steht dies in einer Reihe mit Spielbergs Holocaust-Inszenierungen (übrigens aber ohne an der in manchen Animal Liberation-Diskursen bemühten 'Tier-KZ'-Metaphorik anzustreifen).
In diesem Zusammenhang kommt etwas ins Spiel, was dem Käsewerbungsbauernidyll vielleicht doch eine Rechtfertigung erteilen könnte: Im Bild des silberhaarigen Großvaters, der den seinen Hof durchsuchen lassenden, genüsslich rauchenden deutschen Offizier im Gespräch von dem, was seine Enkelin versteckt, abzulenken versucht, hallt zum einen die prominente Bauernhof-Eröffnungsszene von Tarantinos 'Inglourious Basterds' (2009) nach, zum anderen das Bild des französischen Bauern in Gilles Paquet-Brenners Holocaust-Erinnerungsdrama 'Elle s’appelait Sarah – Sarahs Schlüssel' (2010), der 1942 ein jüdisches Mädchen vor der Gestapo versteckt und später adoptiert. Diesem Retter ebenso wie Spielbergs grand-père leiht Niels Arestrup sein markantes Antlitz. Seine uniformierten Gegenüber im Hof-Durchsuchungsdialog von 'War Horse', zwei deutsche Offiziere, einer plaudernd, der andere plündernd, werden von Darstellern verkörpert (Rainer Bock und Sebastian Hülk), die beide in 'Inglourious Basterds' kleine Parts als Wehrmachtsangehörige, sowie zeitgleich unterschiedlich große Rollen in Hanekes 'Das weiße Band' (2009) gespielt hatten – einem Film, der auf seine Art ein hochfragiles agrarisches Lebensgefüge in einen Ersten Weltkrieg münden ließ, der als Vorgriff auf den Holocaust verstanden sein wollte. Die betreffende, quasi 1914 wie auch 1942 spielende Dialogszene in 'War Horse', auf die die Offenbarung des Dachgeschoss-Verstecks der Pferde folgt, ist als halbtotale Plansequenz inszeniert, die in ihrer Kadrage das Motiv des tödlichen Alles-Sehens und der rettenden Verborgenheit noch einmal abbildet: Ein Gutteil des Bildvordergrundes ist verdeckt von Marmeladegläsern, die während des Gesprächs von den deutschen Plünderern sukzessive abgeräumt werden.
So wie dieser Sichtschutz aus Marmeladegläsern – ein Archiv konservierter Süßlichkeit – sich auflöst, wird auch das eingangs im Bild der frischen Erdbeeren verdichtete, picksüße agrarische Klischee-Idyll gehüteter Unberührtheit hinfällig: Der Großvater kann die Enkelin, so erfahren wir allmählich und etwas indirekt, weder vor der Wahrheit über den kriegsbedingten Tod ihrer Eltern bewahren noch vor dem Verlust ihrer geliebten Pferde an die Besatzer – und auch nicht vor ihrem eigenen Tod. Sein Monolog über französische Brieftauben, deren Mut darin besteht, dass sie, um eine Botschaft zu überliefern, das Grauen der Front überfliegen, ohne hinunterzuschauen, diese herbeigeschriebene Rede steht hier als eine der vielen, oft breitspurigen Spielberg’schen Variationen auf das jüdische Thema des Bildverbots (von 'Duel' bis 'War of the Worlds' …), auf die Tradition eines Gesetzes, das Unterbrechung fordert, Unterbrechung des Sehens und des Lichts. Dem gegenüber kulminiert das Vernichtungswerk des Krieges im Einsatz von Giftgas, das sich als weißer Nebel in einem Graben ausbreitet, bis es das Bild auslöscht im leinwandfüllenden Weiß eines totalen Lichts, das gleichbedeutend mit totaler Blendung ist (und Albert zum Opfer einer vorübergehenden Erblindung macht).
'Like God taking a photograph,' hatte der junge Survivor in 'Empire of the Sun' das Negativ-Wunder des Atombombenabwurfs auf Nagasaki kommentiert. Der Licht-Blitz rührt bei Spielberg von der Totalgewalt einer mythischen, über- oder unmenschlichen Macht; das Rettende und Menschliche hingegen ist dort, wo Licht gerahmt und gefiltert wird: So fallen seine markenzeichenhaften Lichtkegel hier etwa durch die Fenster des englischen Farmhauses; und die Wunderszene von der deutsch-britischen Pferderettung im Niemandsland wird vielleicht dadurch vor dem gänzlichen Absinken ins Klischee gerettet, dass sie zu einem Gutteil zwischen Silhouetten im Gegenlicht abläuft. Das Spielberg’sche Bild hält fest am Blockieren der Sichtbarkeit als Keim der Rettung mitten im Vollzug des massenweisen Mordens, das seinen Lauf nimmt und keineswegs beschönigt wird: Die beiden jungen deutschen Pferdenarren und Armeedeserteure (einen von ihnen spielt David Kross, der 2009 der 'Vorleser' einer einstigen KZ-Aufseherin war) gelangen nie in jenes Italien, von dem sie als Ziel ihrer Flucht schwärmen. (Vielleicht hätten sie nicht von den Reizen italienischer Mädchen reden sollen, denn das ist eine illegitime, unlebbare Position im Kino von Spielberg, das Sex nur in biopolitischer oder 'lebenstechnischer' Vermittlung zulässt.) Stattdessen werden sie am Fuß der Windmühle, in der sie und die beiden Pferde versteckt waren, exekutiert. Die Szene ist in einer schrägen Vogelschau inszeniert, bei der die sich im Vordergrund drehenden Flügel der Windmühle die Gewehrsalve und den Zusammenbruch der beiden jungen Männer abschatten wie die Umlaufblende eines Analogfilmprojektors im Kino.