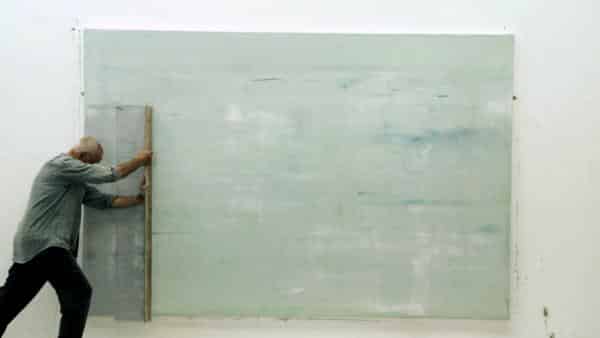Es ist heiß, schon bevor die Sonne aufgeht. Ein Zug fährt durch ein unwirtliches, fremdes Land. Das Fahrgeräusch klingt merkwürdig unecht. In einem Abteil zwei junge Frauen und ein Kind. Die eine schwitzt, die andere hustet Blut ins Taschentuch. Im Nachbarabteil zwei finstere Militärs, auf dem Gegengleis ein nicht endender Güterzug mit Militärpanzern. Irgendwie sehen die aber aus wie schlecht beleuchtete Spielzeugpanzer in Großaufnahme. Der Schaffner ruft etwas ins Abteil, in einer Sprache, die die drei nicht verstehen. Die Reise wird unterbrochen. In der fremden Stadt, in zwei Suiten eines herrschaftlichen Hotel aus der Zeit des Jugendstils warten sie darauf, dass Ester, die Schwerkranke, sich erholt. Der Junge, Johan, erforscht die langen Flure mit einer Spielzeugpistole in der Hand. In einem Aufbäumen gegen ihr Leiden raucht, onaniert und betrinkt sich Ester, bis sie zusammenbricht. Ein skurriler, alter Hotelangestellter nimmt sich ihrer an. Kommunikation in Zeichensprache. Dann wird sie wieder „vernünftig“, arbeitet an einer Übersetzung. Anna, die Gesunde, die Mutter Johans, lässt sich von ihrem Sohn den Rücken einseifen, schläft nackt neben ihm im Bett, streunt durch Spelunken und Varietés, und „hat“ einen Kellner auf dem Fußboden einer Kirche. Später holt sie ihn ins Hotel. Nachts biegt vor dem Hotel ein Panzer um die engen Straßenecken.
Eine merkwürdiger Gefühlsknoten bestimmt das Verhältnis der Schwestern. Ester neidet Anna ihre Sinnlichkeit, aber mehr noch, sie ist „gedemütigt“ durch Annas Liebhaber, weil sie sie „liebt“. Doch je mehr die gesunde Anna diese Liebe spürt, desto mehr muss sie ihre Schwester verletzen – später treibt sie es vor ihren Augen mit dem Mann. Sie weiß, dass sie sie damit nur noch kranker macht. Aber die Kranke will unter den „unsittlichen“, sinnlichen Exzessen ihrer Schwester auch leiden. Masochistische Selbstzerfleischung einer Moralistin?
Die Schizophrenie aus dem Pfarrhaus
Zwei Prinzipien stehen zunächst gegeneinander: Moral, Vernunft, Ordnung gegen Unmoral, Sinnlichkeit, animalische Instinkte. Bemerkenswert, wie okkupiert der Begriff „Moral“ zu Beginn der Sechziger noch war durch so etwas wie Sexualfeindlichkeit. Die „Moral“ jener Zeit war reduziert auf Keuschheit, Sinnenfeindlichkeit, und dementsprechend galt das außereheliche Ausleben von Sexualität als das genuin „Unmoralische“. Kein Ort konnte diesen Konflikt zwischen Lust und Kontrolle, Libido und Scham, „Sündigem“ und Schuld besser bündeln als das traditionelle evangelische Pfarrhaus. Der Pastorensohn Ingmar Bergman ist der Präzedenzfall eines Künstlers, der sich zeitlebens an seinem protestantischen Erbe abgearbeitet hat. In seinen Filmen spiegelt sich – psychoanalytisch reflektiert – die gesamte Phänomenologie einer strengen protestantischen Erziehung, Denkweise, Selbstwahrnehmung, Weltwahrnehmung. Allem voran der unauflösbare Konflikt mit der nicht einlösbaren Schuld des Ich. In der evangelischen Religion wird der Mensch zum Glauben an Gott nur befähigt über die Erkenntnis, dass er in sich selbst immer schwach, schuldhaft, mit Sünde behaftet sei. Erst in dem Akt dieser Art von Selbsterkenntnis und in dem Eingeständnis der totalen eigenen Unzulänglichkeit liegt für den Protestanten die Chance der Vergebung durch Gott. Das bedeutet, dass dem protestantischen „Gut“-Sein-Können immer die Einsicht in das gegebene persönliche „Böse“-Sein vorausgegangen sein muss. Ergebnis dieser Rechnung: Eine latente schizoide Grunddisposition. Denn ein Ich, das sich selbst gleichzeitig, oder kurz aufeinander, als absolut mangelhaft oder als „Werkzeug des Guten“ verstehen muss oder darf, kann sich selbst nicht wirklich verstehen (im Sinne von: akzeptieren), und muss in einer unauflösbaren Angst vor einem starken Über-Ich leben. In der Pfarrhaus-Kindheit wird diese moralische Instanz vom – von Amts wegen mit göttlichen Erkenntnissen und Sanktionsbefugnissen versehenen – strafenden und belohnenden Vater verkörpert. Jenem Vater, dessen moralischer Zeigefinger weiter nach oben verweist, zu Gott, dem allergrößten Über-Ich, das alles sieht. Ein streng protestantisch erzogener Erwachsener leidet häufig an einem überentwickelten Über-Ich, seinem „schlechten Gewissen“. Er empfindet sein Es als etwas „Böses“ und als Bedrohung, versucht daher seine Triebe stärker zu unterdrücken und zu verdrängen als der Normalmensch, und er ist deshalb oft nicht in der Lage ein ausgeglichenes, selbstbewusstes und starkes Ich zu entwickeln, weil ihm verwehrt bleibt, sich in seiner, „Unvollkommenheit“ oder seiner Binarität zu akzeptieren.
Sex und Schuld
Die beiden Frauen in „Das Schweigen“ mögen vielleicht auch Symptome einer modernen Welt sein, in der Kommunikation unmöglich geworden ist – so wie der Film häufig verstanden wurde -, aber eher noch sind sie wie die beiden divergierenden Pole eines protestantisch sozialisierten, sprich: beschädigten, Wesens. Nicht wirklich zwei eigenständige Figuren, sondern ein Es und ein Über-Ich spielen die Hauptrollen in Ingmar Bergmans Film. „Das Schweigen“ portraitiert die ambivalente Psyche eines gründlich mit christlichen Werten beackerten Menschen, der erkannt hat, dass Gott aus seiner Welt verschwunden ist. Was ihm bleibt, ist das fundamentale Bewusstsein seiner Schuld und Schlechtigkeit. Wer hier wirklich schweigt, ist Gott, und was übrig bleibt, ist das, was diesen Gott stets vorbereitet und ermöglicht hat, Gottes wichtigste Vorbedingung: Die Selbstverachtung des Menschen. Diese Selbstverachtung äußert sich im Film am deutlichsten im Umgang der Frauen mit ihrer Sexualität und in der Art der Darstellung von Sexualität generell. Beide sind sexuell gestört. Anna, die Jüngere, Gesunde, Sinnliche steht für das (nicht mehr unversehrte, vom Über-Ich beeinflusste) Es. Sie ist weniger sexsüchtig als zwanghaft promiskuitiv. Für sie ist Sex Flucht, Vergessen, antikommunikativ – an ihrem Liebhaber schätzt sie besonders, dass sie seine Sprache nicht versteht – und Sex ist Trotz, gegen ihre Schwester, also gegen die moralische Instanz (die auch marginal noch in ihr selbst verwurzelt ist), gegen ihr schlechtes Gewissen, das sie versucht zu bekämpfen. Mit dem Grad des Verbotenseins aber – das hat sich einigermaßen herumgesprochen – steigt der Reiz einer Sache und wo ein strenger, allmächtiger Gott ein Gebot/Verbot auferlegt hat, scheint für Anna der Wunsch, es zu übertreten, übermächtig geworden zu sein. Eine wiederholte sexuelle Zwangshandlung also, gegen ein zu starkes Über-Ich. Keine autonome oder erwachsene Entscheidung, nicht ein überdurchschnittlich ausgeprägter Hormonhaushalt treibt sie in die Arme fremder Männer, sondern der Drang, Verbotenes zu tun, moralisch „schlecht“, schmutzig (beim Geschlechtsakt in der Kirche – größtes Sakrileg! – beschmutzt sie tatsächlich ihr Kleid) zu sein, um endgültig verstoßen werden zu können, aus den Moralvorstellungen eines sinnenfeindlichen Elternhauses, aus den „behütenden“ Händen eines Gottes, der Selbstaufgabe und Unterordnung verlangt. Doch Annas „Gewissen“ ist zu stark ausgeprägt, sie kann sich nicht wirklich befreien. Mit jedem Schritt gegen die Norm verletzt sie sich selbst. Weil sie sich und ihre Sexualität als weiterhin schmutzig empfindet und weil ihr die Mittel fehlen, sich argumentativ zu rechtfertigen, sich kulturell und rational zu verteidigen und zu bejahen, wird ihr Emanzipationsversuch scheitern, wird das, was sie tut, immer mit Gewissensbissen behaftet bleiben.
Auf dem Weg in die vaterlose Gesellschaft
Der Vater der Schwestern ist die Schlüsselfigur. Nach seinem Tod wollte Ester nicht mehr weiterleben – und es scheint, als erfülle sich ihr Wunsch. Das Leben hat für Ester seinen Sinn verloren, so sehr hat sie ihren Vater geliebt, so wichtig war er für sie, oder so abhängig war sie von ihm. Der Vater, der Sinnstifter, ist, wenn man so will, Bergmans Pastorenvater, aber zugleich der Vater im Himmel. Im protestantischen Pfarrhaus regiert immer das Phantom zweier Väter, deren klare Grenze für die Psyche von Pastorenkindern nur schwierig zu erfassen ist. Der Vater hat seine Kinder verlassen, die Kinder treiben alleine durch eine Welt mit einer fremden Sprache, die unverständlich bleibt und ohne Sinn, weil sie kein Vater mehr erklärt, weil kein Vater mehr zu ihnen spricht. „Das Schweigen“ steht gleichermaßen für das Schweigen des Vaters wie für das Verstummen Gottes.
Ester, die Übersetzerin, hat nichts mehr zum Übersetzen. All die „guten Büchern“, die sie früher übersetzt habe, haben ihr nicht helfen können, sagt Anna. Ester, das schwache Bindeglied zwischen Metaphysik und Physis, die Schwester mit dem viel ausgeprägteren Über-Ich, mit den hohen Prinzipien, ist arbeitslos geworden, weil (Anna: „Ohne ewig Bedeutungsvolles kannst du nicht existieren!“) sie keine Zeichen und keine Bestätigung mehr bekommt von Gott, auf den sie angewiesen war. Auch hier sind zwei Übertragungen möglich: 1. Der moderne Mensch in der modernen Welt hat seinen Glauben verloren, deshalb ist er allein und ohne eine Aufgabe und sein Leben bedeutungslos geworden. 2. Das Pastorenkind Bergman hatte von klein auf gelernt, dass sein Innerstes sündhaft ist, hatte seine libidinöse Seite verdrängt, sein Über-Ich ausgeprägt, um seinem Vater zu gefallen und festgestellt, dass der versprochene Handel: Angst und Selbsterniedrigung gegen Liebe und Sinngebung von Außen, vom Vater (oder Gott), ein unfairer Handel war.
Schwellkörper, Schleim und Krebsgeschwüre
In einem Interview beschreibt Bergman die Situation, wenn er Zuhause etwas angestellt hatte: Zuerst kam die körperliche Züchtigung, danach die Zeitspanne, in der die Kinder Reue fühlen sollten, das endlos erscheinende Warten auf den Moment, wenn der Vater kommt, man ihn um Entschuldigung bittet und er einem endlich vergibt (im Film „Fanny und Alexander“ (Fanny och Alexander, 1982) stellte Bergman dieses Ritual sehr genau dar). In „Das Schweigen“ kommt der Vater nicht mehr, die Vergebung durch Gott bleibt aus und das Verlorensein in der Sünde ist zum Dauerzustand geworden. Am meisten leidet darunter Ester, die die christlichen Rituale von Sühne und Vergebung schon so internalisiert hat, dass sie weder zu einer trotzigen Sinnlichkeit, wie ihre Schwester, noch zu einer selbständigen und unabhängigen „geistig-moralischen“ Existenz fähig ist. Ihre Verachtung des eigenen Körpers, ihr Ekel vor dem Eros („… alles nur Schwellkörper und Schleim, Schwellkörper und Schleim …“) und der Verlust ihrer (metaphysischen) Stütze durch den Vater oder Gott führen sie in die Krankheit, die Selbstdestruktion, machen sie also rein physisch schon lebensunfähig.
Die Schwestern wirken wie zwei mehr oder weniger gescheiterte Versuche, mit den Resultaten einer strengen christlichen Erziehung – vielleicht auch einem dogmatischen, christlichen Weltbild – zu leben: Ihre gegenseitige Abhängigkeit, ihre Hassliebe aber deutet darauf, dass sie eben, so wie Es und Über-Ich, die verschiedenen Seiten (und deren Selbstgespräche) innerhalb einer einzigen Person sein könnten. Auch die Kamera zeigt ihre Gesichter immer wieder neben- und übereinander arrangiert, beide Gesichter manchmal wie in einem Picasso-Portrait kubistisch zu einem verschmelzend. Doch müssen sie sich immer wieder voneinander trennen. Körper und Geist können nicht zueinander finden. Anna ahnt, dass Ester sie hasst, weil sie sich durch sie bedroht fühlt, doch Anna kann sich nicht erklären warum, ihr fehlen die Worte, der Intellekt, denn sie ist Gefühl und Körper. Anna sehnt sich nach Esters Liebe, weil sie nie vom Vater geliebt wurde, dessen Rolle Ester versucht zu übernehmen. Doch die zu rationale Ester kann ohne Anna, den Körper, die Lust, nicht leben, obwohl sie sich davor ekelt, deshalb ist sie todkrank. Beide sehnen sich nach einem harmonischen Miteinander, nach psychischer Einheit, nach einem Ich, das sie integriert.
Die Kunst als Chance
„Das Schweigen“ analysiert eine seelische Krankheit. Zwei Seiten einer Person sind aufeinander angewiesen, weil jede für sich unvollständig ist. Die innere Zerrissenheit dieser Person ist nur aufzuheben durch eine Instanz, die sie beide gleichermaßen achtet und bejaht. Diese Instanz ist anscheinend nicht vorhanden. Der Vater, Gott, der bisher für eine zweifelhafte Einheit sorgte – denn offenbar hat er Ester mehr geliebt als Anna – ist tot. Es bleibt den beiden Schwestern aber noch ein verbindendes Element, nämlich Annas Sohn Johan. Beide lieben das Kind auf ihre Weise, die Mutter in ihrer Sinnlichkeit, die Tante mit ihrer idealistischen Liebe. Und Johan liebt jede für sich, wie Kinder es tun, auf unvoreingenommene Weise. Johan beobachtet, registriert, nimmt den Konflikt auf, ohne ein Urteil zu fällen. Weil Johan noch nicht „fertig“ ist, besitzt er noch die Freiheit, abzuwägen. Auch wenn seine Liebe noch nicht stark genug ist, die Frauen vor ihrem Schicksal zu bewahren, verkörpert Johan die Chance auf eine Zukunft, in der es zu einer Lösung des Dilemmas kommen könnte. Johan ist die gewonnene Freiheit Bergmans, seinen eigenen biografischen Konflikt distanzierter zu betrachten und Johan ist inmitten der Sprachlosigkeit eine Sprache gegeben, die er versteht und in der er sich artikulieren kann: Die Kunst. Die Liliputaner im Hotel sind ihm nicht nur aufgrund ihrer Größe ähnlich, denn sie sind auch Schauspieler (in ihrem „Spiel“ sind sie auch Kinder, und Johan ist auch ein Puppenspieler), Gaukler, Komödianten. Sie erkennen ihn als einen der ihren und nehmen ihn wie selbstverständlich auf in ihren Kreis. Wenn Gott tot ist, bleiben andere Formen des Fragens, der Suche und der Freiheit zur Distanz, nämlich die der Kunst.
Johan ist Bergmans Weg oder Perspektive sich mit seiner Herkunft und mit sich selbst auseinander zu setzen. Ester schreibt Johan Wörter in der fremden Sprache in einen Brief, Wörter, die er vielleicht verstehen wird, wenn er erwachsen ist. Der alte Glaube kann nicht überleben, er ist auf seine Weise gescheitert, aber vielleicht barg er doch geheime, verschlüsselte Wahrheiten. Johan wird später mehr wissen, wenn er gelernt haben wird, das Erbe seiner Tante zu entziffern. Doch Johan wird vollständiger sein als seine beiden vereinzelten „Mütter“, weil er beide beerben wird, und weil ihm die Kunst vielleicht dazu verhelfen wird, anscheinend Unvereinbares zu vereinen, d.h. zu verstehen.
Porno, Krieg und Männlichkeit
Als „Das Schweigen“ 1964 in die deutschen Kinos kam, stand der Film sofort unter „Pornographieverdacht“. Immerhin gibt es zwei – sittsam bedeckte – Koitusse und zwei Paar nackter Brüste zu sehen – vor Oswald Kolle zuviel (nicht nur) für den deutschen Bürger. Ein Teil der Kritik empfand den Film aber auch als sexualfeindlich, was ja insofern passt, da die praktizierte Sexualität im Film immer als etwas „Schmutziges“, also mit Sündhaftigkeit behaftet, gezeigt wird – fraglich dabei, ob das nur daran liegt, dass sein Thema eine (auch) sexualfeindliche Moral ist. Denn so dunkel und bedrohlich sind die sexuellen Begierden, so sehr reißen sie Anna in einen Schlund der Gleichgültigkeit und seelischen Kälte, dass die Sexualität durchgehend äußerst schlecht abschneidet. Gleichzeitig aber besteht ganze Film – abgesehen von seinen provokanten Szenen – aus sexuellen Unterschwelligkeiten, Konnotationen, und Symbolen, wie sie sich ein Sigmund Freud kaum besser hätte ausdenken können.
Die wirkliche Haupt- und Entwicklungsfigur ist eigentlich Johan, das Kind, mit dessen Augen und Ohren wir eine merkwürdige Welt entdecken. Mit einer „realen“ Außenwelt hat das unheimliche Land im „Schweigen“ nicht viel gemein, abgesehen davon, dass es ein paar „Ostblock“-Stereotypen versammelt. Das Land, in das die Frauen und und das Kind geraten sind, ist ein „Männerland“, und die Männer darin sind meist dumpf, triebhaft, unverstehbar, bedrohlich. Auf den Straßen werden von Männern Befehle gebellt, Leute zusammengetrieben, erschossen. Das Männliche also als fremdartige Bedrohung von Außen. Der Zufluchtsort und die Abgrenzung gegen dieses Außen ist das merkwürdig altmodische und luxuriöse Hotel, worin Frauen von merkwürdigen, aber hilfsbereiten Männern beschützt werden. Nur Anna traut sich hinaus in diese bedrohliche Welt, sie lässt sich auf diese Männerwelt ein, indem sie sie in sich eindringen, sich penetrieren lässt, und als sie den fremden Mann mit in das Hotel nimmt, bricht die männliche Sexualität, und mit ihr alles Bedrohliche, ein in das vorläufige Zuhause Johans. Als Anna mit dem Kellner schläft, drängt zeitgleich ein Panzer – ein kompletter männlicher Geschlechtsapparat – durch die enge Straße. Der Geschlechtsakt als militärische Okkupation, als aggressiv männliches Prinzip. Johans Zuhause, bis dahin ein Ort der relativen Geborgenheit durch zwei Mütter, ist gefährdet durch einen Konkurrenten, den neben dem Kind zweiten physisch mit (seiner physischen) Mutter kommunizierenden Mann, der wahrlich nicht viel von einer Vaterfigur hat, dessen Rolle aber, wie die eines (unvertrauten) Vaters, den klassisch freudschen Ödipus-Konflikt hervorruft.
Wenn Vater schwieg
Wenn das Fremde das Männliche ist, und wenn die Männer eher unverstehbar bleiben, dann mag das auch von der Abwesenheit der Väter dieser halben Familie herrühren: Johans Großvater, vermutlich ein Mann von großer Autorität, ist gestorben und hat offenbar keinen Nachfolger mehr in Johans Vater gefunden, der sich entweder nicht für Frau und Kind interessiert, oder von seiner promiskuitiven Frau bald verlassen wurde. Präsente, das heißt auch lebendige und psychologisch nachvollziehbare Männer gibt es nicht in Johans Familie. Nur von Männern allein gelassene Frauen. Bergman sagte zwar zu seinem Film, auch Männer hätten für ihn vorstellbare Hauptfiguren in „Das Schweigen“ sein können, vermutlich aber hätten wir dann nicht so viel über Bergmans Verhältnis zu seinem „emotional abwesenden“ Vater erfahren, den er als in seinem Beruf sehr repräsentativen, moralischen, im Privaten aber als sehr unsicheren, überempfindlichen und zurückgezogenen Menschen beschrieben hat. Der Vater als einerseits strenge moralische Instanz und als Repräsentant seiner Religion, andererseits als psychisch nicht autonome Persönlichkeit, also keine einfache männliche Identifikationsfigur. Auch hierauf passen wieder zwei Interpretationen, die individuelle: ein zum Scheitern verurteiltes, da schizoides protestantisches männliches Konzept, also das fehlende funktionierende Vorbild für ein männliches Kind – daraus resultierend ein Unbehagen und ein Misstrauen gegenüber jeglicher Maskulinität – und die gesellschaftliche: die spürbare Auflösung eines funktionierenden (männlich geprägten) Überbaus, z.B. die des Patriarchats in den sechziger Jahren, welche bekanntlich zunächst zu der eher „femininen“ Hippiebewegung und später zum offen antiautoritären Aufbegehren gegen sämtliche patriarchischen Strukturen in der Gesellschaft führte.
Wenn Männlichkeit infolge ihrer Verlustes an Integrität und Glaubwürdigkeit eher zu reiner Roheit und aggressiver Stumpfheit verkommen ist, bleiben nur „weibliche“ Konzepte wie Zärtlichkeit und Sensibilität. Beides findet Johan bei seinen „Müttern“; aber nur ansatzweise, denn die Frauen haben ja nicht lernen können, sich in ihrer Weiblichkeit zu emanzipieren, und wenn Anna sich zwar von Johans Vater getrennt haben mag, wenn sie auch einen – etwas zwanghaften – Weg zum Ausleben ihrer Sinnlichkeit gefunden hat, so kann sie sich doch nie richtig von ihrem schlechten Gewissen trennen, auch nicht, wenn sie dagegen an kopuliert. Die physisch nicht lebensfähige Ester hingegen verfügt über geistige und kulturelle Werte, wie über die Musik Johann Sebastian Bachs. „Musik“ übrigens ist das einzige Wort, das es auch in der fremden Sprache gibt, eben so wie auch die Sprache der Musik (=der Kunst) von jedem Menschen verstanden werden kann, und sie steht – speziell aber natürlich die Musik Bachs – für ein humanistisches (aber – typisch für Bergman – heimlich auch wieder christliches) kulturelles Erbe, das offenbar den Vater und scheinbar selbst Gott überdauert hat. Ester hat sich also ideelle Werte erhalten, aber sie kann sie ihrer Schwester nicht vermitteln, weil die alten kulturellen und moralischen Konzepte nicht den ganzen Menschen berücksichtigen, velleicht auch nie berücksichtigt haben. Fragmentarische Personen und Lebenskonzepte, durch Gott, Vater und Patriarchat beschädigt, also sind diese Frauen, weibliche scheiternde Lösungsversuche, die zu integrieren nur Johan, der zukünftige „neue“ Mann vielleicht in der Lage sein wird. Auch dieser Lösung mag noch ein Rest patriarchischen Denkens durch den Regiseur innewohnen.
Europäisches Kino der Einsamkeit
„Das Schweigen“ reihte sich – einmal abgesehen von der typisch Bergman’schen moralischen Zerknirschung – ein in einen neuen europäischen Filmtypus zu Beginn der sechziger Jahre, der das Ende alter Wertvorstellungen, das Problem einer Moderne der Einsamkeit und Kommunikationslosigkeit thematisiert hatte. Michelangelo Antonioni mit „Liebe 1962“ (L’Ecclise, 1962) und einigen anderen Filmen, Federico Fellini mit „Das süße Leben“ (La Dolce Vita, 1962) und „Achteinhalb“ (8 ½, 1963), Louis Malle mit „Das Irrlicht“ (Le Feu Follet, 1963), beschrieben ziellose Existenzen in einer Gegenwart, in der gesellschaftliche Konventionen nur noch leere Formen und Rituale geworden sind, für die aber auch die Flucht in die Ekstase oder Dekadenz kein Ersatz sein kann. Während Antonioni die Einsamen seiner Filme sehr distanziert und mit kühler Ästhetik beobachtete, entwickelten Alain Resnais, Fellini (besonders in „Achteinhalb“) und Bergman eine Filmsprache der personalen Subjektivität, des Unbewussten, innerer, seelischer Zustände – beeinflusst durch die Freudsche Traumdeutung und Psychoanalyse und mit Anklängen an die Surrealisten, wie z.B. Buñuel („Das goldene Zeitalter“; L’Age d’or, 1930). Das Haus oder die Wohnung (so wie das Hotel in „Das Schweigen“) standen bei manchen dieser Filme für die Persönlichkeit, die ihre verschiedenen Impulse und Normen versucht zu koordinieren, und die sich von außen bedroht fühlt. Sicherlich beeinflusst durch „Das Schweigen“ zeigte Polanski in „Ekel“ (Repulsion, 1965) den zur Realität werdenden Alptraum einer durch (männliche) Sexualität verstörten Frau, die sich in ihrer Wohnung verschanzt. Im Unterschied zu „Das Schweigen“, worin die stilisiert alptraumhafte Wirklichkeit nie in Frage gestellt oder außer Kraft gesetzt wird, aber unterscheidet Polanski in „Ekel“ eher, was darin subjektiv verzerrte Wirklichkeit und was real sein soll. Durchweg künstliche, innere Wirklichkeit symbolisierende Welten wie in „Das Schweigen“ gab es vorher auch in Alain Resnais’ Film „Letztes Jahr in Marienbad“ (L’Année dernière à Marienbad, 1961) und über zehn Jahre später in David Lynchs erstem Langfilm: „Eraserhead“ (1977).
Schweigen und Zerknirschung
Wie schon erwähnt, wurde „Das Schweigen“ gemeinhin als Metapher für das Verschwinden Gottes gedeutet und mit dem Erscheinen des Films wurde Ingmar Bergman eine Wandlung zum Agnostiker attestiert. Wie eine Befreiung von protestantischen Dogmen und Zwängen wirkt der Film allerdings noch kaum. Mit jeder Minute seines Schweigens, mit jeder weiteren sündhaften Handlung der Menschen wird die Moral und sozusagen die negative Präsenz dieses Gottes umso deutlicher, erdrückender und schwerwiegender – und sein Schweigen umso lauter. Zu einem großen Teil handelt der Film von Schuld und Schuldgefühlen, und so auch insgeheim von der Sehnsucht nach einer Vergebung durch einen eben nicht toten, sondern noch irgendwo verborgenen Gott. Würde ein Regisseur seinen Film „Das Schweigen“ nennen, wenn er dabei nicht an ein Subjekt denken würde, das des Sprechens mächtig ist, das also auch existiert?
Erst sehr viele Filme und Kämpfe später, vielleicht am ehesten mit seinem Film „Fanny und Alexander“, scheint Bergman wirklich gelernt zu haben, Vater und Gott, protestantische Erziehung und Glauben als etwas von einander Getrenntes, gänzlich Verschiedenes zu betrachten und Gott aus seinem Entitätenkatalog zu eliminieren – seine protestantischen Ängste aber umso genauer unter die Lupe zu nehmen. Dass er mit „Fanny und Alexander“ tief mitten ins fiese Herz des (puritanischen) Protestantismus getroffen hat, möchte ich mir, in meiner Eigenschaft als Pastorensohn, erlauben zu bestätigen. „Das Schweigen“ hat schon Ansätze dessen, was „Fanny und Alexander“ perfektionieren wird, aber ist teilweise noch verstrickt in nicht abtragbare moralische Zerknirschung. Diese protestantisch-abendländische Zerknirschung, diese prüde, sexualfeindliche und ziemlich unmenschliche Haltung ist allerdings auch zu Beginn der Sechziger in Europa – auch unter „Nicht-Pastorentöchtern“ – viel weiter verbreitet gewesen als zu ihrem Ende, als die sogenannte „Sexuelle Revolution“ stattfand. Bergmans gebrochen protestantischer Blick, die schuldgedrückte, freudlose, ja absolut humorfreie Zeichnung moralisch verwerflicher Verhältnisse, die „Das Schweigen“ exemplarisch vormachte, hat sich allerdings noch lange gehalten, zumindest im konservativen Fernsehen, im deutschen, in einer Fernsehserie wie „Der Kommissar“, worin häufig die sexuelle Freizügigkeit irgendwelcher Hippiemädchen zwangsläufig Mord oder Totschlag nach sich zog. „Kommissar“-Autor Herbert Reinecker hat später auch Folgen der bekannteren Kriminal-Serie „Derrick“ geschrieben, und die lief bis in die Neunziger. So viel zu unser aller christlichem, protestantischem, patriarchischem Erbe …