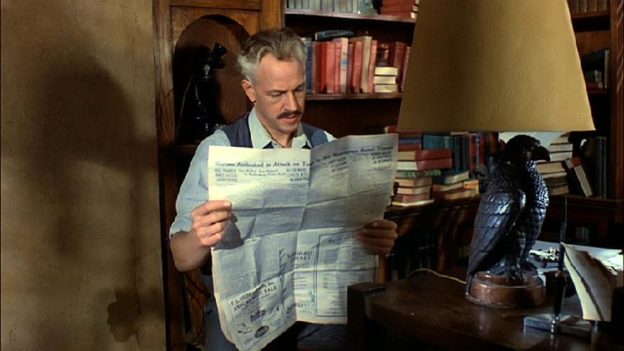Angewandte Filmkritik #41: Grimme Preis
„Für die Darstellung eines Rechtsterroristen erhielt er den Grimme-Preis.“
Aus der Vita des Schauspielers Albrecht Schuch in einem Filmpresseheft. Der Preis ist ihm durchaus zu gönnen und es war bestimmt eine tolle Leistung. Dennoch hat der Grund für die Auszeichnung durchaus schräge Züge. Wer hierzulande den Rechtsterroristen am schönsten spielt, bekommt auch den schönsten Preis.
* * *
Angewandte Filmkritik #42: Peter Fonda
Den kürzlich verstorbenen Peter Fonda habe ich etwas um die Ecke kennengelernt. Mehr aus Blödsinn nahm ich an einem Preisausschreiben der Kölner Boulevard-Zeitung „Express“ teil. Wir gewannen zwei Karten für die Premiere einer überarbeiteten Version von „Lawrence von Arabien“, mit VIP-Karte für die After-Show-Party. Auf der fand sich dann neben Prominenten wie Bernhard Wicki auch der „Easy Rider“-Star Peter Fonda ein. Am Büffett gab es Gulaschsuppe in ausgehöhlten Broten. Wenn sie zu lange herumstanden, weichte der Behälter auf und die Suppe machte Flecken.
Ich stand neben Wicki, der stark gehbehindert war und nicht aufstehen konnte. Mit Kino hatte ich damals nicht mehr als andere am Hut, ich studierte Germanistik, da lag das Gewicht auf Buch. Aber ich jobbte nebenbei in einer Kneipe mit dem passenden Namen Laterne, also bot ich Wicki meine Kompetenzen an – Bier holen.
Peter Fonda, dessen berühmter Film damals quasi turnusgemäß in den Programmkinos lief, in einem sogar als 24-Stunden-Schleife, stand die Party mit Jeansjacke und getönter Brille sehr gut. Auch er fand das mit dem Bier eine gute Idee. Und so hatte ich schon als Student eine frühe Rolle im großen Kino gefunden: Den Rest des Abends war ich für die beiden Superstars als Kellner unterwegs; in eigener Sache natürlich auch. Das klappte sehr gut, schließlich hatten wir nach jedem Gang einen mehr sitzen. Jetzt habe ich leider einen toten Saufkumpel mehr.
Und vielleicht sollte das ja generell die Rolle der Filmkritik sein: das Kino bei guter Laune halten. Schade, dass du dich verabschiedet hast, cooler Mann mit getönter Brille.
„Lawrence von Arabien“ kommt nicht mehr so oft im Fernsehen. Aber der Abend mit Fonda fällt mir immer ein, wenn ich den Film „Prometheus II“ sehe: Dort spielt Michael Fassbender einen Androiden, der Peter O’Toole als Lawrence von Arabien imitiert.
Eine wunderbare Szene: Obwohl völlig ohne Fonda, sorgt sie dafür, dass einer an ihn denkt.
* * *
Angewandte Filmkritik #43: Pfilmfest 2019
Das Pornfilmfestival Berlin hat sich dieses Jahr weitgehend ohne Sexszenen verabschiedet. Nun ist „Porn“ eh schon nicht gleich „Porno“, sondern eher die diskursive Variante davon. Mit Pornografie politische Inhalte vermitteln, ist das Ding.
Nicht das erste Mal verzichtete der ein oder andere Film auf Sichtbares (Publikum: „Gestern bei den Kurzfilmen war aber mehr los“). So ging es etwa im diesjährigen Abschlussfilm „Die traurigen Mädchen aus den Bergen“ von Candy Flip und Theo Meow um eben jene Handvoll junger Frauen, die ihre Essstörungen und Depressionen mit dem Dreh von Sexfilmen bekämpfen und das Geld natürlich an die kurdischen Frauenmilizen in Rojava überweisen. Anderthalb Buchstabendreher weiter: Das ist weniger kurdisch denn krude. Angesichts der aktuellen Ereignisse in Kurdistan scheint diese Vereinnahmung krass daneben.
Oder? Der Dreh soll ausschließlich mit Sexarbeit finanziert worden sein. Die Fake-Doku, in der ein schräger Reporter die Frauen im Kaukasus aufsucht, wo sie eine billige Wohnung gefunden haben, ist so grottig, dass man kaum hingucken kann. Die Schauspieler tun einem schon leid. Zudem sollte die ausgiebige Lektüre identitätslinker Magazine in den Liner Notes als Inspiration genannt werden. Bruce LaBruce darf auch nicht fehlen: Die traurigen Mädchen sind eine Variation seines Films „The Misandrists“, der auch schon recht sperrig zu gucken war.
Diese Melange fand man toll in Berlin, der Film gewann den Hauptpreis. Und wer weiß, was aus den Newcomer-Regisseuren einmal wird – auf einmal drehen sie in Hollywood. Denn wie dem auch sei: Um das Festival, das jetzt auch schon 13 Jahre besteht, hat sich eine ganze kleine Filmindustrie gebildet, in der sich mit billigsten Mitteln Abendfüllendes produzieren lässt. Das ist auch eine Leistung.
* * *
Angewandte Filmkritik #44: Mini
Vom Klimawandel mag man halten, was man will. Aber wenn in der hiesigen Autoindustrie das Licht ausgeht, sollen die Verantwortlichen nicht sagen, sie hätten von nichts gewusst. Beim letzten regulären Kinobesuch hatte ich die Gelegenheit, den neuesten Werbespot von Mini zu begutachten. Wobei Mini ein Euphemismus ist.
Der zum BMW-Konzern gehörende Flitzer wurde schon vor Jahren auf SUV-Größe (18 Zollräder, 250 km/h Spitze) aufgeplustert. Die aktuelle Ausgabe bringt es denn auch auf 306 PS. Das reicht für den schnellen Einkauf im Stadtverkehr, das macht auch der Spot klar. Ein Typ Ende 20, Hipsterbart, muss mit seinem 306-PS-„Mini“ vor der Ampel warten. Nervös stochert er auf dem Gaspedal herum, irgendwo leuchtet eine grüne Fußgängerampel auf. Schemenhaft bewegt sich ein alter Mann mit Krückstock offensichtlich zu langsam über die Straße – abgesehen davon, dass ein normaler Mensch bei derzeit gängigen Fußgängergrünphasen so was nicht schafft, wenn er nicht fit für einen 100-Meter-Sprint in Katar ist.
Jetzt tritt der Idiot noch mehr aufs Gas, fast sieht man den Qualm aus den Nasenlöchern ziehen. Was soll uns das sagen: Will der Typ alte Menschen umbringen? Es ist schleierhaft, wie so was etwa nach dem Unfall in Berlin-Mitte, wo ein außer Kontrolle geratener Riesenkarren vier Menschen tötete, in der Öffentlichkeit laufen kann.
* * *
Angewandte Filmkritik #45: Bad Boys 3
Will Smith dürfte der Ruhm gebühren, eines der bescheuertsten Kleidungsstücke der Welt in seinem Besitz zu haben. Anlässlich der Präsentation seines neuesten Streifen „Bad Boys“ Teil 3 mit Pressekonferenz im Berliner Hotel Adlon kam der Mann in einem rotkarierten T-Shirt mit aufgedruckter Anzugweste nach Deutschland. Die imitierten Taschenaufschläge waren weiß. Der Hollywoodstar sah aus, als hätte er sich mit der Knoblauchsoße aus einem Döner eingesaut.
Da verschiedene Privatsender Werbespots zu „Bad Boys“ aussandten, die an dem Tag mit Smith gedreht worden waren, verfolgte einen besagtes T-Shirt noch eine Weile.
Immerhin war ich so mal wieder im Adlon, vielen Dank, Filmindustrie! Das letzte Mal war ich bei Al Gore, der immer Cowboystiefel trägt, auch wenn das im Anzug seltsam aussieht. Die waren der Presse wichtiger als Gores neuer Klimawandel-Film. Smith hätte das Hemd – wie Gore seine Stiefel – auch im Film tragen sollen, es wäre jetzt der Merchandise-Hit.
Der Film übrigens, eine Katastrophe: Zwei alte Polizisten bringen halb Mexiko um, weil sich der Filmsmith mit seinem ungezogenen Filmsohn streitet. Ob den Darstellern gar nicht auffällt, wie sie in ihren Filmrollen marodieren? Polizeigewalt, USA, hä? Aber womöglich erkennen sich viele Eltern in der Story wieder. Der Sohn dealt, der Vater kontert mit Panzerabwehrraketen, ein ganz normaler Sonntagmorgen in der Mittelschicht. Muss man sich wundern, dass der Film gleich auf Platz 1 der deutschen Kinostarts stand?
Dennoch würde man sich wünschen, Leute wie Smith würden sich jetzt auch mal einen schönen Arthouse-Filmregisseur fürs würdige Alterswerk aussuchen – Super-Action-Star spielt alten Pornosüchtigen, inszeniert von Lars von Trier, Premiere ist in Cannes. Oder was Schnarchiges von Wim Wenders. Das T-Shirt sollte der Held dabei unbedingt anbehalten.
* * *
Angewandte Filmkritik #46: Schlingensief 2020
Fast zehn Jahre tot ist der arme Christoph Schlingensief, aber mir macht er dieses Jahr noch ein Geschenk: „Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“ heißt der Film von Bettina Böhler, der dem Genie nachspürt. Er läuft am 2. April an, und das ist mein Geburtstag!
Einmal sollte ich sogar bei Schlingensief auftreten, das hatte sich dann aber wieder erledigt. Ich habe aber schöne Erinnerungen an ihn. Einmal hatte ich die Gelegenheit, ihn zu Hause zu besuchen. „Konkret“-Filmkritiker Dietrich Kuhlbrodt schauspielerte bei ihm und meinte, ich solle mal vorbeikommen. In einem großen Zimmer saßen die Schauspieler und lernten wie die Schulkinder Texte von Gilles Deleuze und Félix Guattari auswendig. Beide starben zu Schlingensiefs besten Zeiten, der eine ist gar aus dem Fenster gesprungen.
Sie feierten bei Schlingensief ihr Comeback, mich hatten sie schon Jahre zuvor im Studium drangekriegt. Der King of Kettensägentrash machte einen Schrank auf, voller krasser Magazine. „Guck mal, ich war grad in Japan, da hab ich mir die Hefte mitgebracht.“ Ich sag jetzt mal lieber nicht, was darin zu sehen war.
Ich setzte mich auf ein extra schönes Sofa. Kuhlbrodt erzählte, das sei die Einrichtung der Räume des ehemaligen Hamburger Gerichtspräsidenten. Der hatte die als Sperrmüll auf die Straße gestellt. Kuhlbrodt, damals noch Oberstaatsanwalt, ließ einen Transporter kommen, sicherte die Möbel und schenkte sie später Schlingensief.
„Wir haben den ‚Anti-Ödipus‘ zu zweit geschrieben. Da jeder von uns mehrere war, machte das schon eine Menge aus“, schreiben Deleuze und Guattari in ihrer Kultschrift „Rhizom“ vorneweg. Also danke mehrmals, liebe Bettina-Böhler- und Christoph-Schlingensief-Mehrheiten – dass ihr den Filmstart auf diesen Tag gelegt habt.
* * *
Angewandte Filmkritik #47: Oppenheimer
Joshua Oppenheimer ist ein Ausnahmeregisseur. Seine Filme handeln von Massenmorden wie zum Beispiel jenem an den Kommunisten in Indonesien im Jahr 1965: Eine Million Menschen sollen von faschistischen Banden umgebracht worden sein, viele wurden zuvor denunziert.
Heute sitzen die Schläger in indonesischen Talkshows und geben sich als überzeugte Patrioten. Oppenheimer muss deshalb am Set und in der Vorbereitung irgendwas Besonderes machen. In „The Act of Killing“ bringt er die Mörder vor die Kamera, lässt sie das Geschehene nachstellen. Sie entpuppen sich als Kino-Fans. Freimütig erzählen sie, wie sie ihre Opfer umbrachten. Sie lachen viel. Am Ende kotzen sie.
Den zweiten Film zum Thema, „The Look of Silence“, widmet Oppenheimer den Hinterbliebenen der Opfer, im Mittelpunkt der Indonesier Adi Rukun, der den Mord an seinem Bruder aufklären will. Im Verlauf der Dreharbeiten stellt sich heraus, dass sogar der eigene Onkel mit den Mördern kooperierte.
Oppenheimer hat diese Filme in Deutschland selbst vorgestellt, und das ist nicht weniger beeindruckend. Viele seiner Familienmitglieder wurden Opfer des Holocaust – dies sei ein starkes Moment in seiner Arbeit, sagt er. Die wenigsten, die diese Filme sehen, gehen völlig unbeeindruckt aus dem Kino. Bei anderen weiß man es nicht. „The Look of Silence“ sah ich mit rund 200 anderen Leuten, sitzend auf der Atriumtreppe einer Stiftung in Berlin. Auch mit jener jungen Frau in der Reihe hinter uns, die einen Döner mit Knoblauchsoße aß, der noch in der Alufolie („Zum Mitnehmen, bitte“) steckte – knister knister -, während vorn über Folter geredet wurde. Über totes Fleisch, das verscharrt wurde, nachdem sein Eigentümer umgebracht worden war.
Was mag sie gedacht haben, als sie mit ihren Fingern jedes seinerseits tote Fleischstück einzeln aus dem Brot holte und sich in den Mund führte? Für ihre Mahlzeit brauchte sie genau so lang, wie Oppenheimer für sein Thema. Zur Diskussion mit dem Regisseur war sie beim Salat angekommen.
Auch so geht Kino, das Popcorn-: Vorne läuft Massenmord, hinten wird gemampft.
* * *
Angewandte Filmkritik #48: GNTM
Dass Heidi Klum mit ihren „Germany’s Next Topmodels“ in die Jahre gekommen sein könnte, stand zu befürchten. Die mittlerweile 15. Staffel ließ aber mit ihrer Besetzung sämtliche Zweifel an der Show verstummen. Die zum Teil minderjährigen Teilnehmerinnen können gestandenen Unternehmern locker Tipps in Selbstmarketing geben. Nebenbei verhandelte die gewiefte Chefin mit dem Model-Nachwuchs Themen wie Morbus Krohn, Armut in Familien und den Tod – mindestens zwei Kandidatinnen waren über Unfälle und Krankheit gleich mehrere Familienmitglieder abhanden gekommen.
Nicht zu vergessen die Corona-Krise (Klum: „Ich hatte ja gerade einen Parasit“).
Vor allem ist Heidi Klums Show aber auch eine große Sprachmaschine. Hier meine Favoriten:
„Mädchen, ich brauche jetzt ein bisschen mehr attention.“
„Ich fürchte, ich bin on board for elimination.“
„Ich habe hier viele neue Wörter gelernt. Zum Beispiel ‚cringe‘ – das steht dafür, dass man sich für etwas schämt. Fremdschämt. Im Grunde: Man schämt sich für sich selber fremd.“
Wem wäre es nicht auch schon so gegangen. Slavoj Žižek kann einpacken. Danke, Tamara.
* * *
Angewandte Filmkritik #49: Corona Cineplex
Das Kino „Corona Cineplex Kaufbeuren“ kündigt an:
Das Dante-Projekt. Dauer: 180 Minuten. Genre: Ballett / Live-Übertragung aus dem Royal Opera House London. Am 28.5.20, 20:15 Uhr.
Und nein – es ist nicht das Inferno. Sondern: Die Göttliche Komödie.
Hoffen wir, dass nicht die komplette Kultur – vermutlich mit Ausnahme des Autokinos und so gern sie in diesem Magazin gedisst wird – den Bach runtergeht. Die Kinos, denen es vorher schon nicht gut ging, weil das Publikum ausblieb, könnt ihr in diesen Zeiten, wo Publikum verboten ist, zum Beispiel hier unterstützen – je mehr Werbevideos man anguckt, desto mehr Einnahmen fürs Lieblingskino: https://hilfdeinemkino.de/
Viele Verleiher und auch Kinos setzen derzeit auch auf Video on Demand. Der Erhaltung des Kinos als Ort der Zusammenkunft – was könnte schöner sein, als in einer rühen Nachmittagsvorstellung allein zu sitzen, ohne Gequatsche von vorn und hinten und dem Geknister von Popcorn und Brötchentüte – nützt dies allerdings genau nichts.
* * *
Angewandte Filmkritik #50: ZDF
Ob der 8. Mai ein offizieller Feiertag in Deutschland sein sollte? Diese Frage wird uns spätestens nächstes Jahr wieder beschäftigen. Heißt es Niederlage oder Befreiung? Leitartikler und TV-Kommentatoren wollten und werden es richten.
Wie dem auch sei: Eines hätte eigentlich sicher sein sollen: Der Zweite Weltkrieg müsste vorbei sein. Oder? Nicht überall:
ZDFzeit: Wir im Krieg. Privatfilme aus Hitlers Reich
hieß es am Stichtag beim Zweiten Deutschen Fernsehen. Zu sehen eine „Dokumentation mit privatem und teils unveröffentlichtem Filmmaterial – neue Einblicke in das Leben während des Zweiten Weltkrieges.“
Etwa die „Aufnahmen einer Unternehmerfamilie aus Stuttgart, deren Firmensitz als einziges Gebäude auf dem zentralen Marktplatz einen schweren Bombenangriff überstand. Es zeigt die Angehörigen beim Versuch, ihr Haus mit einem Tarnanstrich zu schützen, aber auch in der Freizeit, bei scheinbar unbeschwerten Ausflügen ins Grüne.“
Ist auch bekannt, was die Zwangsarbeiter des Unternehmens in der Zeit machten, die leider keine Kamera zur Hand hatten? Mit dem Zweiten sieht man besser; oder wie der echte Privatfunk sagen würde: Mittendrin statt nur dabei. Wer das „Wir“ hier ist, das da auf die Gegenwart verweist und so unbeschwert im Grünen Freizeit macht, kann man nur erahnen. Vielleicht sitzen sie ja heute noch dort – und die ZDF-Redakteure mit ihren Privatfilmen sind so um die 90 Jahr alt. „Hitlers Reich“ ist auch schön. Ein bisschen wie Reich Christi, jedenfalls recht gottgegeben. Für „Nazi-Staat“ war wohl kein Platz in der Titelzeile, obwohl das sogar kürzer gewesen wäre.
Am 8. Mai war der Zweite Weltkrieg vorbei? Macht nichts: Wir haben ja noch das Zweite Deutsche Fernseh-Reich mit seinen privaten Einblicken.
Diese Texte sind zuerst erschienen in: Konkret
Hier geht es zur Angewandten Filmkritik 31-40.
Bild: Woody Allens „Annie Hall“ (1977) (© MGM / 20th Century Fox)