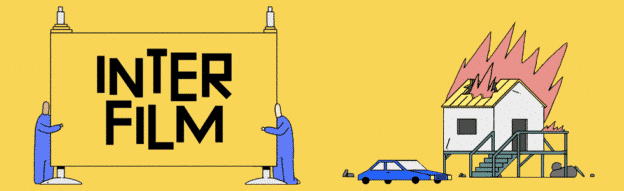Im Selbstzerstörungsmodus
Das Internationale Kurzfilmfestival Berlin wurde 1981 von Heinz Hermanns in den besetzten Häusern Berlin-Kreuzbergs als internationales Super-8-Filmfestival “interfilm 1” gegründet. Es griff aktuelle politische Umbrüche auf und zeigte unter anderem Filme, die von Hausbesetzern im Häuserkampf und bei Demonstrationen gedreht worden waren. Auf diesen Gründungsmythos beruft sich das Festival nach mehr als 30 Jahren noch immer. Doch – das verrät ein Blick auf die mittlerweile 36. Edition, die 2020 vom 10. November bis zum 13. Dezember online stattfindet – mit der Rauheit, Spontanität, Improvisationslust und Kreativität besetzter Häuser hat das Festival heute nichts mehr am Hut.
* * *
Wie es sich für ein Festival gehört, wird bei Interfilm immer eine Menge gefeiert. Vor allem feiert man in den letzten Jahren zunehmend sich selbst. Da gerät die Eröffnungszeremonie schon mal zu einem mehr als zweieinhalbstündigen Marathon der Selbstbeweihräucherung, sodass dem Publikum am Ende nichts anderes übrig bleibt, als jeden Satz und jeden Film in der Hoffnung auf ein baldiges Ende müde wegzuklatschen, wie es 2017 der Fall war. Passend dazu rennt der Moderator überdreht von einem Bühnenende zum anderen und stammelt irgendwelches Zeug von der Verletzlichkeit des Menschen in Berlin und den ganzen Möglichkeiten dieser verrückten aber irgendwie auch geilen Stadt. Der hohle Arm-aber-sexy-Hedonismus trifft hier auf oberflächliche Gesellschaftsanalyse, die irgendwann sauer aufstoßen.
Ein Jahr später beschreibt ein anderer Moderator der Eröffnung die ganze Kraft des Kurzfilms einleitend mithilfe einer Playstation-Werbung, die er mal gesehen und die ihn umgehauen hat. Kirsten Niehuus, Geschäftsführerin von Gottes Gnaden des Medienboard Berlin-Brandenburg, welches das Festival fördert, spricht nicht minder ergreifende Worte in ihrer Ansprache: Sie sei im Taxi gekommen und das ging so schnell, dass sie keine Zeit hatte, sich eine Rede einfallen zu lassen, aber Interfilm sei ganz toll. Später wird ein schwarzer Filmemacher auf die Bühne gezerrt und gefragt, wie er Berlin fände. Zwei Sätze werden ihm gegönnt, für die Einladung darf er sich auch brav bedanken und ohne den Hauch einer Kontextualisierung zu liefern, wird er wieder entlassen. Hauptsache, man hat demonstriert, wie divers und engagiert man bei Interfilm ist – bis sich irgendwann nur noch weiße, alte Männer auf der Bühne bestätigend zunicken und alles super finden. Wozu in Fettnäpfchen treten, wenn es Fritteusen gibt.
Es passt somit ganz gut ins Bild, dass man auch 2020 in der coronabedingten Onlineeröffnung nichts Essenzielles zu sagen hat – außer, dass viele Filme in vielen Programme laufen – und der Berliner Senator für Kultur, Klaus Lederer, bei der aufgezeichneten Ansprache in seinem grauen Flipchart-Büro wie ein Fallmanager im Jobcenter um die Ecke ausschaut.
Aber Schwamm drüber, Eröffnungen sind Eröffnungen. Da kann schon mal was schiefgehen – jedes Jahr aufs Neue. Was zählt sind die ausgewählten Filme. Über diese kommuniziert ein Festival mit den Zuschauer*innen und demonstriert, welches Weltbild und welches Bild vom Publikum es hat. Im Jahr 2020 musste sich Interfilm aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkleinern, doch die verbleibenden etwa 350 Filme geben einen guten Überblick über den aktuellen Zustand von Berlins größtem Kurzfilmfestival. Schnell fällt dabei ins Auge, dass Experimentalfilme und Essayfilme im Grunde keinen Platz haben. Ist in der Selbstbeschreibung von „Vielseitigkeit und Aktualität“ die Rede, schaut in Wirklichkeit alles nach der Niedrigschwelligkeit eines Kessel Buntes aus. Die Gelegenheit mit dem Zwang zur Verkleinerung auch die Spreu vom Weizen zu trennen, haben die Verantwortlichen offenbar nicht genutzt. Im Gegenteil wurden scheinbar beliebig Programme aus dem viel zu großen Festivalkorpus (in einem durchschnittlichen Jahr zeigt Interfilm allein um die 13 bis 16 Spezialprogramme!) geschnitten. Auch die Tradition allen Wettbewerbs- und Focusprogrammen einen Titel zu verpassen führt nicht zu einem besseren Verständnis der Selektion: „Curiosities“ heißt ein Programm, „Encounters of another kind“ ein anderes und je mehr Filme man aus diesen Programmen sieht, umso deutlicher wird, dass jeder Film problemlos auch unter einem der anderen auf maximale Unverfänglichkeit getrimmten Titel hätte laufen können.
* * *
So stehen im Internationalen Wettbewerb die interessanten Filme („My Galactic Twin Galaction“, R: Sasha Svirsky; „Freeze Frame“, R: Soetkin Verstegen) zwischen peinlichstem Bilderdurchfall. Altherrenfilmchen über das unterdrückte Sexualverhalten lüsterner Männer („Zwart“, R: Tom Geraedts) wechseln sich mit handwerklich soliden Animationen („Marie Boudin“, R: Margot Barbé) ab. Die Auswahl ist, inhaltlich wie künstlerisch, geprägt von Routine und der Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Die Programme zu dominieren scheinen Filme mit einer klaren Dramaturgie und Botschaft, eindimensionalen Figuren und nicht selten einer am Fernsehen, der Werbung oder dem Imagefilm geschulten Ästhetik, wenngleich der Kurzfilm eigentlich eher dafür steht, die Muster der Filmökonomie zu torpedieren.
In „I‘m a pedophile“ (R: Johanna Ställberg) will sich ein Mann seiner Schwester gegenüber als pädophil outen. Dramaturgisch krankt der Film aber schon an seinem Titel. Von Beginn an ist klar, worauf es hinausläuft, doch das Warten darauf ist in etwa so dämlich wie das Warten, ob in „Schindlers Liste“ (USA 1995; R: Steven Spielberg) aus den Duschköpfen nun Wasser oder Gas strömt. Mit einem fragilen Thema wird dramaturgischer Unsinn betrieben. Die Figuren reagieren erwartbar: Die Schwester brüllt, der Sohn der Schwester prügelt. Alle sind überfordert. Die Kamera bildet all das so einfallslos und altbacken ab, dass ein zweifelhafter Voyeurismus mit der Zeit die Bilder hässlich färbt.
Dämlicher noch ist „Vigile“ (R: Xavier Beauchesne-Rondeau), der sich auf dumpfbackige Art die rassistischen Auswüchse einer Nachbarschaftswache vornimmt: Nach der angeblich traumatischen Begegnung seiner Tochter mit einem arabischstämmigen Mann beschließt Papa in der Nachbarschaft aufzuräumen und organisiert eine Patrouille. Zur selben Zeit zieht der Schwarze Blaise in eine neue Wohnung direkt gegenüber. Allerdämlichste Vorurteile rumpeln da durch den Kiez, trennen gut und böse jalapenoscharf voneinander und liefern eine niedliche Pointe, in der Papa und seine Hobbyfaschogang bekommen, was – die Parallelmontage kündigt es an – von vornherein zu erwarten war.
Und auch in „Hate“ (R: Humza Arshad) geht es um Gewalt gegen Andersdenkende und -aussehende. Diesmal aber mit manipulativen Gänsehautstreichern und bedeutungsschwangerem Off-Kommentar. Beides trichtert einem auf plumpe Weise von der ersten bis zur letzten Minute die richtigen Gefühle ein, und weil das noch nicht intensiv genug ist, gibt es im besten Kampagnenstil Zeitlupe obendrauf, damit auch der letzte noch kapiert, wie schlimm Gewalt und Rassismus sind.
Exemplarisch stehen diese Filme für die sich nach und nach abzeichnende Maxime in der Filmauswahl: Vermeintlich „wichtig“ muss das Thema sein, also aktuelle gesellschaftspolitische Themen wie Migration, Frauenfeindlichkeit oder Klima berühren. Das an sich stellt kein Problem dar, doch ist es wie so häufig eine Frage des Verhältnisses, denn die Ethik wird zum leitenden Prinzip vieler Filme bei Interfilm. Die Ästhetik spielt eine untergeordnete Rolle. Doch „wichtig“ wird ein Film nicht allein durch sein gewähltes Thema, sondern gerade durch seine Umsetzung. Filme, die ihre Moral plump vor sich hertragen wie ein Namensschild um den Hals, tendieren dazu, nicht den Gegenstand der Betrachtung, sondern seine Macher*innen und die Gefühle des Publikums in den Vordergrund zu rücken. Kino wird so zu einer moralische Instanz, die einer Ohnmacht im Angesicht politischer und ökologischer Krisen nicht Ausdruck verleihen, sondern ein Gefühl der Sicherheit geben will, dass man zumindest auf der richtigen Seite steht. Dies wiederum erklärt das radikale Fehlen offener Formen des Kurzfilmes, wie beispielsweise des Experimentalfilms, bei Interfilm.
Wie schief dieses verkürzte Verständnis von Film gehen kann, zeigt der im Wettbewerb laufende Oscargewinner „Skin“ (R: Guy Nattiv). Ein blöder, weißer Hillbilly, der seinem Sohn Schießen und ordentlich Hass beibringt, verprügelt hier einen Schwarzen auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt, weil Letzterer den Sohn des Alt-Right-Heinis an der Kasse angesprochen hat. Das alles geschieht vor den Augen der Kinder des Schwarzen. Am Ende wird Nazipapi dafür dann hart bestraft. Die Botschaft ist – nicht zuletzt aufgrund der Eindimensionalität der Figuren und ihrer Verortung – klar: Rassismus ist ein Problem, aber er kommt eben nur in Randgruppen vor und ist keinesfalls im Kern der amerikanischen Gesellschaft zu verorten. Vor allem aber ist Hass erlernt und das – dafür stehen die Kinder im Film symbolisch – auf beiden Seiten. „Skin“ marginalisiert Rassismus also nicht nur, Schwarz und Weiß werden zudem (auch das Poster zum Film zeigt dies überdeutlich) gleichgesetzt, obwohl diese Gleichsetzung aufgrund der Historie unmöglich ist. Der Film thematisiert Hautfarbe auf erschreckend naive Art und Weise und löscht mit seiner Nivellierung jeglichen Diskurs darüber im selben Atemzug aus. Dass der Film obendrein bei Interfilm in einem Programm läuft, welches den sehr tanzbaren Titel „Staying Alive“ trägt, setzt dem ganzen Mist dann noch die Fettnapf-Krone auf.

© Fox Search Light / Guy Nattiv
Die maximale Gedankenlosigkeit bei der Programmierung von Filmen mit vermeintlich wichtigen Themen setzt sich auch in den Programmen für Human Rights fort. Als ob es in den anderen Wettbewerbsprogrammen nicht schon genug Werke gäbe, die mit viel Tamm Tamm, Hundeblick und Kitsch mit Soße zeigen wollen, wie politisch sie doch sind, schwingen zwei Confrontations-Programme am Ende des Internationalen Wettbewerbs die Moralkeule noch einmal denjenigen entgegen, die von den ersten sieben Wettbewerbsblöcken noch nicht niedergeschlagen wurden: Frauen scheinen irgendwie im Zentrum eines Programmes zu stehen, wenngleich sich auch ein Film über Rassismus darin tummelt. „Changing Perspectives“ verspricht der Titel, das Programm folgt aber eher den Logiken der „Selbstvergewisserungsindustrie“ (Cornelia Koppetsch) eines ethisch ambitionierten Kinos, als Perspektiven wirklich einmal umzukehren und die Zuschauer*innen in unangenehme Situationen zu versetzen und sie damit allein zu lassen. Film wird hier nicht als kritisches Gegenüber verstanden, sondern soll ein Publikum ansprechen, das sich bei einem Gläschen Wein noch einmal versichern kann, wie schrecklich alles ist. Doch das Prinzip der Gefälligkeit führt bei Interfilm zu einer Verengung der Möglichkeiten. Und die Menschenrechte lassen sich auch weder von der Couch noch aus dem Kinosessel heraus verteidigen, schon gar nicht mit Kitsch, dessen Funktion per se nicht die Aktivierung, sondern die Beschwichtigung ist, denn in seiner Zugänglichkeit liegen allzu oft Zudringlichkeit und emotionale Übergriffigkeit verborgen. Eine zum Handeln befähigende „Resonanz“ (Hartmut Rosa) jedoch kann erst dann entstehen, wenn das Gesehene zu einem gewissen Grad überfordert und unverfügbar bleibt, sich den Zuschauer*innen also immer wieder – das heißt auch im Erkenntnisprozess – entzieht. Erst auf diese Weise kann sich der Film über den Kinosaal hinaus verlängern und zu einem Nachdenken anregen.
* * *
Als endgültig grotesk und oberflächlich entlarvt sich der Wunsch nach der hehren Verteidigung der Menschenrechte mit dem (schon grammatikalisch widersinnigen) Spezialprogramm China New Talents. Es versammelt Filme staatlicher Hochschulen, die häufig über allererste filmische Gehversuche nicht hinauskommen. Und weil der chinesische Staat natürlich ein Auge auf die eigene Kunst hat, verlieren sich diese Filme thematisch im Ungefähren und offenbaren die Kehrseite universellen Erzählens: Im Grunde genommen kommt China in diesem Programm kaum vor. Es ist beinahe so, als hätte das Land in den vergangenen 20 Jahren keinerlei Umbrüche und damit zusammenhängende Verwerfungen erlebt, als müssten derzeit nicht etwa ein bis zwei Millionen Menschen aufgrund ihres Glaubens und zum Zwecke der Umerziehung ihr Dasein in Lagern fristen oder als würde das Land der aufgehenden Sonne nicht mit dem Social Credit System seine Bürger*innen einem Kontrollsystem unterwerfen wollen, gegen das sich die orwellschen Fantasien wie kalter Kaffee ausnehmen. Selbst die aktuelle Situation Hong Kongs wird nicht reflektiert. Wie man sich für Menschenrechte einsetzten und zugleich solchen linientreuen Käse zustande bringen kann, bleibt eines der ungelösten Rätsel bei diesem – seine kognitiven Dissonanzen offen auslebenden – Festival.
* * *
Selbst im Dokumentarfilmwettbewerb – lange Zeit eine der stärkeren Reihen bei Interfilm – machen sich 2020 Filme breit, die dem beschriebenen Muster folgen und zum Teil nicht einmal mehr als Dokumentarfilme bezeichnet werden können. Zwei Werke stechen besonders unangenehm hervor:
„Waves“ von Jessie Ayles über drei Mädchen, die ihre Angst vor sexueller Gewalt in Kapstadt nur beim Surfen für einen Moment besiegen können, nimmt sich ein wichtiges Thema vor und macht daraus einen Imagefilm voller sonnendurchfluteter Zeitlupenbilder, die aussehen wie überteuertes Stock Footage und eher davon erzählen, dass die Macherin jegliches Gefühl dafür, welche Bilder eigentlich angebracht sind, vollkommen verloren hat. Mit jedem Schnitt verhärtet sich die Frage, wann das Produkt, für das hier Werbung gemacht werden soll, eingeblendet wird. Aber was soll man von einer Werbefilmerin erwarten, die auf ihrer Webseite ihr besonderes Interesse für Geschichten mit sozialem Bewusstsein, in denen marginalisierte Stimmen und Themen aus der ganzen Welt hervorgehoben werden, betont und unter diesem Marketingsprech dann so sozial engagierte Firmen wie Nike, Google, Nissan und Louis Vuitton auflistet, für die sie schon gearbeitet hat.

© Jessie Ayles
Daneben steht „Diana – The Only Female Professional Boxer in Uganda“ von Adam Anthony, der die einzige weibliche Boxerin Ugandas portraitiert, die kurz vor den Olympischen Spielen aufgrund ihres Geschlechts disqualifiziert wurde und trotz aller negativen Erfahrungen heute voller Hoffnung andere Frauen trainiert. Spannendes Thema, doch wie so oft hat man nach den knapp fünf Minuten Laufzeit im Grunde genommen nichts erfahren, was der Filmtitel nicht schon verrät. Inhaltsleer, desinteressiert an der Person oder Hintergründen bleibt das Gefühl, dass man einen an Bildern armen Trailer zum eigentlichen Film geschaut hat. Der Inhaltismus eines nur oberflächlich feministischen Kinos siegt über Fragen angemessener Darstellung und notwendiger Tiefgründigkeit.
* * *
Um es noch einmal deutlich zu formulieren: Das Problem sind nicht einzelne, fragwürdige Filme, die zwischen durchaus bemerkenswerten anderen laufen, sondern die prinzipielle Rückwärtsgewandtheit und Widersprüchlichkeit in der Gesamtauswahl von Interfilm: Man gibt sich politisch und vielseitig, doch die Programme durchweht ästhetisch ein Duft von Opas ungelüfteter Wohnung, in der die Möbel von vor 30 Jahren langsam von den Holzwürmern zerfressen werden. Man gibt sich feministisch und queer, zugleich verpasst man einem Programm den an Peinlichkeit kaum zu überbietenden Titel „Sex and Confusion“ und zeigt darin (übrigens jedes Jahr aufs Neue) oberflächliche, sexistische und einfach dümmliche Filmchen zu den Themen Liebe, Sex und Leidenschaft. Das alles hat mit der behaupteten Haltung und vor allem bewusster Kuration, die man sich bei Interfilm gern auf die Fahnen schreibt, einfach nichts zu tun, denn Kuratieren ist das ganze Gegenteil eines bloßen Aggregierens von Content. Ein ausgesprochen sorgsam kuratiertes Programm wie das zum Schwerpunkt Poskolonialismus – in dem die Nachdenklichkeit des Kinos auch einmal zugelassen wird; wo nicht die Antwort, wohliges Schauern, der flache Witz oder naive Hoffnungen breitgetreten werden – wirkt da wie von einem anderen Stern, kann das jämmerliche Absaufen des Kahns aber auch nicht mehr verhindern, weil eine prinzipielle Fehlentwicklung nun einmal nicht durch eine Handvoll Filme ausgeglichen werden kann.
Bei allem Respekt vor der harten Arbeit, die das Team von Interfilm in eine Festivaledition stecken musste, die aufgrund der Corona-Pandemie sicherlich nicht leicht zu stemmen gewesen ist, Interfilm ist ein Kurzfilmfestival, das einer kunstoffenen Hauptstadt nicht gerecht wird. Seit Jahren zerlegt sich das Festival künstlerisch ohne große Not selbst. 2020 treten die Probleme in der „komprimierteren“ Form besonders eklatant zu Tage. Die künstlerische Leitung muss sich die Frage gefallen lassen, wie sie der grundsätzlich sentimentalen, antiprogressiven und streckenweise infantilen Ausstrahlung des Programms mit Hang zur Belanglosigkeit in Zukunft begegnen will, denn Berlin wäre ärmer ohne ein gutes (und nicht nur viel zu großes) Kurzfilmfestival.
* * *
Interfilm – 36. Internationales Kurzfilmfestival Berlin findet in diesem Jahr ausschließlich online zwischen dem 10.11. und 13.12.2020 auf sooner.de statt. Mit einem Abo zum Preis von 7,95 Euro haben Zuschauer*innen nicht nur Zugang zum Programm von Interfilm, sondern bekommen obendrein noch einen Monat für die Inhalte auf sooner.de spendiert.