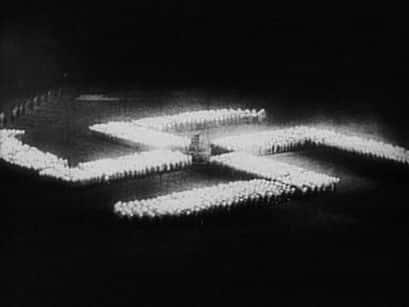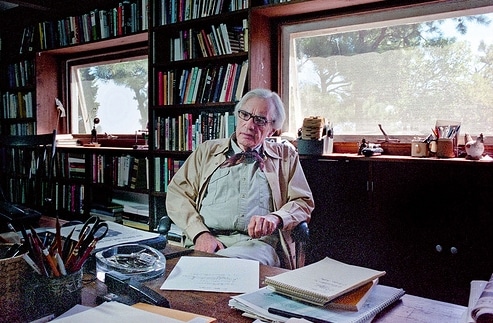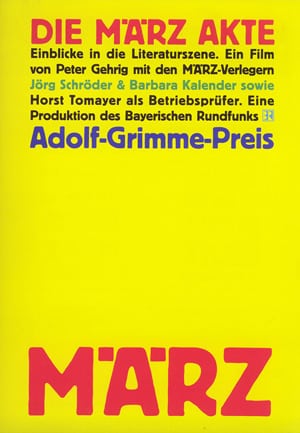'Full Metal Jacket', Stanley Kubricks Vietnamfilm, ist kein Film bloß über den Vietnamkrieg. Jedenfalls bleibt er nicht dabei stehen, sondern verfolgt das Thema Vietnam weiter bis in die heil geglaubten Welten der US-Rock-&-Pop-Kultur
Hart wie Kruppstahl hatte sich der Führer die Jugend gewünscht, durchschlagend wie ein Stahlmantelgeschoss der Marines-Ausbilder in Stanley Kubricks neuem Film 'Full Metal Jacket'. Gunnery Sergeant Hartman (Lee Ermey) ist freilich das erste Opfer der Tötungsmaschinen, zu denen er die Marinerekruten abgerichtet hat. Im Camp Parris Island, South Carolina, auf dem peinlich desinfizierten Massenklo, glubscht ihn Private Pyle (Vincent D’Onofrio) von unten her an, die Augen verdreht, ganz Tücke, entmenschlicht, man kennt die Großaufnahme von (Kubricks) 'Clockwork Orange', und dann kriegt der Drillmeister ein Stahlmantelgeschoss in den Kopf, dass das Gehirn an die sanitären Kacheln platscht und ein Blutstrahl in den Abort schießt, so sehr Blut, so sehr Strahl, so abartig, wie es noch keine Filmeinstellung zuwege gebracht hat. / Schnitt / Und direkt dran hört man Nancy Sinatra mit ihrem Oldierunner 'These Boots are made for Walkin‘ ', wobei die Schuhe eine Jungprostituierte anhat, Vietnamesin, 1968 in Hue, die Tet-Offensive kommt erst noch, die Marines sind voll drauf: 'Ich bin so geil', sagt das Mädchen, und Nancy Sinatras Boots sind für den Strich gemacht.
'Full Metal Jacket' setzt den mörderischen Exzess neben das Liebvertraute, was zu dem Resultat führt, dass man Nancy Sinatras Songs, was man schon längst hätte tun sollen, fortan mit Grauen hört. Andererseits erscheinen uns die Kriegsgreuel in Vietnam dank der Sechziger-Jahre-Musik gar nicht mehr so fremdartig, nämlich als das Ding, mit dem man wirklich nichts zu tun hat. Denn die Musik macht die Kriegsbilder zu Greuel-Oldies und Vietnam-Pop, und das müssen alle Oldies- und Pop-Fans selbst verantworten. Da Bild und Musik sich im Film tückisch gegenseitig infizieren, sind wir unversehens emotional Beteiligte, auf ambivalente Weise gleichermaßen mitschuldig wie mitentlastet, überführt und euphorisch verschubt.
Ja, es ist schon richtig, Kubricks neuer Film ist nicht sauber durchzuanalysieren; dem aufgeklärten Spießer gönnt er die Ruhe nicht und nicht den Frieden, dass Freund und Feind beizeiten sortiert sind und man sich zurückziehen kann vom garstigen Geschäft des Botschaftenverdauens. Stattdessen gibt es abenteuerliche bis wahnsinnige Montagen, geradezu schizophrene Ausbrüche. Nie und nimmer wird man den Showdown zwischen dem vietnamesischen Flintenweib und dem Trupp Marines-Helden akzeptieren. Eine full-metal-jacketed bullett im Bauch fleht die tapfere Feindin die US-Kämpfer um Sterbehilfe an. Die wird auch gewährt, gnädig und nach Überwindung der fälligen Skrupel. – Eine empörende, verlogene Szene, die richtig wütend macht. Sie schlägt auf unbegreifliche Weise nicht auf den Film zurück, sondern macht das starke Gefühl, wenn der Bauch sich mit Wut füllt oder wenn The Trashmen zu Kampf- und Massakerbildern mit 'Surfin‘ Bird' in den Körper dröhnen.
Wo also ist Vietnam in Kubricks neuem Film? Mitten in 'Surfin‘ Bird' und infolgedessen mitten in der US-Rock-&-Pop-Kultur, mitten unter uns, zumindest mitten unter den Oldie-Fans. Und was uns fremd wird, ist nicht mehr der Krieg fern in Vietnam, sondern die vertraute Melodie am heimischen Herd oder wie man sonst den Ort nennen will, wo man ungefragt seinen Tagesbedarf reinzieht.
'Full Metal Jacket' hat all den Vietnamfilmen, die seit einigen Jahren in Mode geraten sind, voraus, dass er sich nicht damit zufrieden gibt, etwas zum Vietnamkrieg zu sagen, sondern dass er, wenn auch nicht explizit, so doch nachhaltig, zum Vietnam-in-uns vordringt. Mit anderen Worten: 'Full Metal Jacket' ist der beste aller Vietnam-Filme auch und grade, weil man zu viele Worte braucht, um dies zu begründen. Wer in anderen Kubrickfilmen mitgehört hat, wird sich erinnern, dass ein einzelnes, populäres Musikstück, hineinversetzt in eine andere Welt, mehr und Eindringlicheres zu sagen hatte als die längste Argumentation. 'Try a Little Tenderness' begleitete 'Dr. Strangelove' auf dem Flug, auf dem er gelernt hatte, die Bombe zu lieben. Und die 'Schöne blaue Donau' war es, ausgerechnet, die dem Flug von '2001, Odyssee im Weltraum' zur Euphorie der Schwerelosigkeit verhalf. In 'Full Metal Jacket' kommt Johnny Wright mit dem schulterklopfenden 'Hello Vietnam' daher. Sam the Sham and the Pharaos törnen mit 'Wooly Bully' zu etwas an, das, so vertraut es ist, widerlich wird. Und 'I Like It Like That' von Chris Kenner verleidet in diesem Film die sechziger Jahre, die sonst endgültig nostalgisch verklärt erschienen. Aber, dass wir’s nicht vergessen: andererseits hören wir die Oldies gern, nichtsdestotrotz. Damit muss jeder selbst fertigwerden. Man kann die Ambivalenz lieben, man kann sich ein wenig spalten, man muss ja nicht nur ein und dieselbe Identität haben, jedenfalls hält einen der Film noch für ein Weilchen beschäftigt.
Wem zu Ehren zogen die Amerikaner in den Krieg? Dem Schlusslied zu glauben ist es die hochverehrte, stets belachte, eng und lang vertraute Mickey Mouse Herself. Mit diesem Lied auf den Lippen fliegen die Marines in die Heimat zurück. Eine gemütliche Regression. Und ein ungemütliches, zynisches Bild, das Kubrick in seinem Film entwirft. Welche Art von Gesetzlichkeit ist das, die zum Vietnamkrieg geführt hat? Dem Film zufolge hilft uns der politische Diskurs nicht recht weiter, jedoch eher schon die Sensibilität für eine populäre und durchaus aktuelle Kultur, in der auch wir drinstecken, nicht nur politisch Verbündete des Marines-Staates. Hören wir auf die Musik in diesem Film.
Achja, die Handlung. Zunächst einmal ist der Film dramaturgisch risikoreich in zwei Teile gespalten. Teil 1: Rekrutendrill auf Parris Island. Teil 2: Straßenkampf in Hue, Vietnam. Im Einzelnen: Rituale der Entmenschlichung und des Untergangs der Individualität in einer Gesellschaft der Gewalt und des Zynismus. Der Ausweg ist Mord, Wahnsinn und die bewusste Spaltung. Sehr plakativ hat sich Private Joker (Matthew Modine) 'Born To Kill' auf den Helm gemalt, einerseits. Und andererseits hat er sich an seine Uniform das Runenzeichen der Friedensbewegung gesteckt, und er lässt sich das von keinem Chef wegnehmen.
Das Zeichen, das die diversen Feinde lähmen und bannen soll, ist nicht mehr das christliche Kreuz, sondern das Grafitto und der Button der Popkultur. Was mit 'Born To Kill' beschworen werden soll, hat in den USA seine Tradition. Die Männer hatten ihren Spruch drauf, wenn sie von der wasserstoffsuperoxidblonden Busenfrau sprachen, die wie eine Bombe einschlug. 'Born for men': so wird Jean Harlow in einem sehr populären Film von 1933 angepriesen. Sein Titel: 'Blonde Bombshell'.
Das Friedenszeichen als Pop-Button – da inszeniert der G.I., dressed to kill, seine propere Gesinnung, und jeder weiß auch heute, was das ist: praktizierender Anhänger der Button-Kultur zu sein; auch wenn sie ein wenig außer Mode gekommen ist; denn die aktuellen Styling-Rituale eröffnen vielfältigere Möglichkeiten. Da also heute alle bestens Bescheid darüber wissen, wie die Verständigung über die Selbst-Inszenierung läuft (und schon viel weniger darüber, wie die Kommunikation über den Diskurs zu bewerkstelligen ist), halte ich es für eine sehr geschickte und effektive Strategie, die ich dem guten alten Kubrick gar nicht mehr zugetraut hätte, mit dem Thema Vietnam sozusagen in der eigenen Etappe zu operieren. Weg sind die klaren Fronten, nämlich: wo ist der Freund? Wo der Feind?
Involviert wird mit dieser Inzenierungstechnik stattdessen das aktuelle real existierende, d.h. postmoderne Publikum, das auf Signale zu reagieren geübt ist. Womit gesagt sein soll, dass der Film am besten und ganz vorzüglich und völlig überraschend und buchstäblich entwaffnend auf die Art und Weise funktioniert, wie er was signalisiert. Wir könnten also sagen, dass es der Stil und die Ästhetik des Films selbst sind, die etwas zu sagen haben. Da diese Wörter jedoch negativ besetzt sind, und da wir uns die Mühe der Argumentation ersparen wollen, dass Stil nicht mit Schöngeistigem und Prätentiösem gleichzusetzen sei, bleiben wir gleich beim Angelsächsischen und loben das eindeutig positiv besetzte Styling des Films, ein böses, zynisches, unverschämtes Styling, pervers und genau. Je grotesker und pointierter, desto näher ist die Inszenierung der Realität eines Zeitgeistes – auch wenn man ihn damals, zur Vietnam-Zeit, nicht so nannte – , der auch heute grässlich vertraut erscheint, nur das modische Outfit ist leicht verändert. 'Full Metal Jacket' begnügt sich nicht mit der Abbildung der äußeren Realität (des Camps, des Kriegs), und er beschränkt sich nicht auf die biedere Rolle, pädagogisches Vehikel für den Transport von Botschaften zu sein. 'Full Metal Jacket' ist bösartiger Sado-Pop im ersten Akt (Ausbildungslager), zynischer Gruftie-Look in den Kriegs- und Massaker-Nummern des zweiten Akts. Attraktiv; abstoßend; ambivalent; das Lachen gefriert. Fallen öffnen sich für beifälliges Grienen. Die Stimmung schwankt und wird in Steil- und Sturzflügen strapaziert. Ein Kriegsfilm wie 'Der steinerne Garten' (Coppola) bietet daneben nicht mehr, als auf den Bildern zu sehen ist: Friedhofsruhe.
Unruhe, Reizauslöser und Signale dagegen in Kubricks Film. Das große Vietnam-Feeling als Grafitti ('Born To Kill'), als Button, als Mickey Mouse, als Rolling Stones (in der 'Paint It Black'-Nummer). Die Comic-Helden sind in 'Full Metal Jacket' präsent: Bugs Bunny, der Quasselhase der bekannten Brutalostrips, sitzt rosarot und dick und plüschig in einer Ruine der Stadt Hue, zum Zugreifen. Endlich was Bekanntes, Heimatliches! (Und wie soll man das Trauma Vietnam loswerden, wenn man – und keiner weiß da ein Rezept – die Comic-Monster nicht loswird). Halt, Kubrick wusste ein Rezept. In seinem Film greift ein U.S.-Soldat zum Witztier, unbesehen, und löst damit einen Sprengsatz aus. Bugs Bunny und Soldier in tausend Stücken. Wenn das nicht bitterböse und groteskkomisch ist.
Weiteres Signal für alle Kinorezipienten: Schnobkram. Wer isst den jelly doughnut? Ein qualliger Rekrut, der Private Pyle. Und es ist, was jedem Konsumenten sauer aufstoßen wird, ein Strafessen in einer besonders üblen Schikaneszene; man kann die Schikane besonders gut nachvollziehen, nicht weil einem der Typ leid tut, sondern weil einem diese allseits geschätzte Leckerei vergällt wird. Außerdem: da 'jelly' mit dem Wort 'Qualle' verbunden ist und 'doughnut', wie man weiß, ein populärer Ausdruck für den U.S. infantryman ist, verspeist Quallen-Pyle seine Kameraden, einen nach den andern. Das ist augenfällig, denn Kubrick hat die Szene choreographisch arrangiert: die Rekruten liegen schon am Boden – im Liegestütz, vom Schinder-Sergeant Hartman kannibalistisch kommandiert. Einen Happs für Qualle, ein Pumpen für die anderen, die ersten liegen schon entseelt da, verzehrt sozusagen.
Die Doughnut-Szene braucht ebensowenig einen Kommentar wie die Kurzgeschichte, die in einem Song erzählt wird. Freilich gibt es Schwierigkeiten bei der Synchronisation. Die macht die doughnuts zum deutschen Pfannengebäck: zu Berlinern. O.k., gegessen. Aber zum Kameradenfraß taugen sie nicht, weil Berliner nicht Rekruten in Parris Island sind, jedenfalls soweit ich weiß. Und wer den Film deutsch hört / sieht, wird niemals vollziehen, warum die Rekruten so besonders grausam sich an Kamerad Pyle rächen werden.
Sgt. Hartman stilisiert sich selbst – im Drill der Rekruten. Sein Wahnsinn, seine Perversion finden eine Form im Einüben eines militäreigenen Tanz-Lauf-Marschier-Schrittes. Die Kommandos werden normal, Ballettstunde, Ritual. Ich krieg es nicht mehr aus dem Kopf raus, wie er zum Laufschritt seiner Rekruten skandiert: 'One – Two – Three – Four / U – S – Marine – Corps'. Oder: 'One – Two – Three – Four / I – love – Marine – Corps'. Und so weiter. Unerschöpflich. Ein Ritual, das alle anderen Gedanken ausschließt. – Die Kamera, wie immer in diesem Film, unterstreicht die Styling-Szene. Affirmativ, läuft sie vor dem Marsch-Körper her, guckt zurück und macht ihn zum grandiosen Organismus, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl, die Jungs. Aber sie ist überaffirmativ, hemmungslos. Die Stilisierung macht es, dass die Ausbildungsbilder gewalttätig werden, gefährlich, entmenscht, unbeeinflussbar. – Kubrick verstopfte sorgfältig die Fluchtwege. Zum Beispiel bietet er so gut wie gar nicht die sonst grade im amerikanischen Film üblichen individual-psychologischen Erklärungsmuster an, an die sich zu halten der Kinogänger sonst geübt ist. Schuld hat der böse Vater, die böse Mutter, die böse Ehe? Nichts davon in 'Full Metal Jacket'. Wir sind als Rezipienten und Konsumenten des Spiels direkt angesprochen.
Kubrick stellt uns nicht Menschen vor, mit denen man immerhin noch versuchen könnte, ins Gespräch zu kommen, sondern Artisten: Künstler, die ihr Fach verstehen und die man nicht mitten in der Vorstellung unterbricht. Wie das Publikum im Kino – auch das ein Rezeptionsmuster, das in die Filmstruktur eingegangen ist – , sind die Rekruten auf dem Kasernenhof gebannt, wenn Sgt. Hartman, der Spieß, seine Fäkalarien erklingen lässt, eine kunstvolle Litanei auf den Grundtönen Votze, Arsch und Ficken. Lee Ermey spielt die Rolle, und er spielt sie perfekt. Er ist Meister seines Fachs, und ich glaube es sofort, dass Ermey selbst mit 17 Jahren ins US-Marine-Corps eintrat, selbst Ausbilder war und seine reichen Erfahrungen für die Vietnam-Filme 'Apocalypse Now', 'The Boys in Company C' und 'Purple Hearts' ('Einmal Hölle und zurück') nutzbar machte. In 'Full Metal Jacket' wird Lee Ermey zum Kunstwerk, unzugänglich, unangreifbar und umso gefährlicher. Wieder setzt die Kamera eins drauf. Sie fährt ihm in den Rachen, das Zäpfchen füllt die Großaufnahme. Hinter ihm die geschorenen Rekruten, jeder auf einem kleinen Podest, einheitlich kostümiert, die Hände vorgestreckt zum Sauberkeitsappell: das ist wieder die klinisch saubere Choreographie, kurz vorm – bitterbösen – Musical. – Im Kino gibt es zur verbalen Scheiß-Ästhetik Lee Ermeys falsche Lacher. Während er – im Film – die Rekruten zur Sau macht, lässt er – im Kino – die Sau los. Grade das meine ich damit, dass der Film mit Fleiß und Nutzen die gängigen Rezeptionsmuster aktiviert. Übrigens werden die Lacher allmählich dünner, schließlich bleiben sie im Hals stecken. Das ging denn doch zu weit: die Welt als Veranstaltung der Marine.
Was haben wir am Massenmörder Charles Whitman und am Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald zu loben? Nun, beide waren Marinesoldaten, und 'sie haben bewiesen, was ein einziger Marine und sein Gewehr vollbringen können'. – Rekruten-Sex? Das Gewehr kommt ins Bett, das Geschlecht bleibt ungewiss. – Wozu ist Weihnachten da? 'Der Pastor erzählt Euch, wie die freie Welt die Kommis besiegt: mit Gottes Hilfe und ein paar Marines'. – Sprüche, die zelebriert werden, jedes Stück ein Clip für sich, so perfekt, dass nirgendwo Platz für Widerspruch bleibt. Wohin mit der Wut? Ab in den Bauch.
Zweiter Akt. Auch der Straßenkampf in Hue wird meisterhaft zelebriert. Ich habe in der Vorstellung, in der ich war, zwar keinen Beifall gehört. Aber sicher waren alle viel zu ergriffen, nachdem die Pyrotechnik Flammen noch in die kleinste Fensterhöhle gesetzt hatte. – Wieder liegt es mir fern, mich darüber zu mokieren. Denn das Artifizielle macht Sinn. Endlich einmal ist Vietnam nicht in den fernen exotischen Urwald verlegt. Kampf in einer Stadt, in einem Industrieviertel wie überall, wie in unserer Stadt. Wir sind dicht beim Thema 'Vietnam in uns'. – Gedreht hat Kubrick den zweiten Teil des Films auf dem Abbruchgelände von British Gas PLC North Thames. Die Palmen waren aus Spanien herangeflogen und die angeblich 100 000 künstlichen Tropenpflanzen aus Hongkong. Der Art Director machte die Industrieanlagen während der zwei Monate Drehzeit mit der Abrissbirne allmählich dem Erdboden gleich.
Abriss-Ästhetik, Open-Air-Performance, Son-et-lumière-Spektakel: der Vietnamkrieg rückt nah, er wird produzierbar, wiederholbar, Service-Angebot. Es fehlen noch die Manager. – Die Ästhetisierung des Kriegs und der Massaker, die bei jedem andern in die Unverbindlichkeit geführt hätten, wird bei Kubrick zum Thema. Wer sagt, dass es heute keine Kriegs-Konsumenten gäbe, die das Spektakel als Performance genössen oder als Service nutzten? Private Joker, Reporter der Marine-Zeitung 'Stars and Stripes', fliegt in einem Militärhubschrauber übers Land. Neben ihm, an der offenen Tür, sitzt ein Typ in totaler Euphorie, happy, schwitzend, und feuert nach draußen, tacktacktack: 'Äi Mann! Schon 157 Schlitzaugen umgelegt und 50 Wasserbüffel!' – Die Kamera schwenkt nach draußen: Frauen und Kinder stieben auseinander, auf der Suche nach dem nächsten Wassergraben. – Das Bild, das noch besser gepasst hätte, wäre allerdings der häusliche Monitor gewesen und von der Diskette ein tolles Programm mit Laufwerk. Wer killt in welcher Zeit die meisten gooks? Desaktivieren macht Spaß!
Oder so: Popkultur aktivieren ist geil! Wer veranstaltet den nächsten Krieg? Spätestens wenn sofort an dieser Stelle 'Wooly Bully' reindröhnt, der alte Titel von Sam the Sham and the Pharaos, kriegt man Angst vor der Antwort. – Für wen ist der Krieg willkommenes Ereignis? In einer besonders zynischen Sequenz lässt Kubrick Kamerateams der US-Fernsehstationen durch die Schlacht fahren, die Soldaten unterbrechen ihr blutiges Geschäft, um routiniert in die Kamera zu grinsen und das zu sagen, was das Publikum hören will. Kubrick gelingt es, dies so zu bringen, dass uns die Lust vergangen ist, die Bilder zu sehen, die die Realität abbilden sollen: Sie sind von vornherein falsch.
Richtig sind die aggressiven Inszenierungen und Zuspitzungen vor den Prospekten – oder sagen wir: umstellt vor den Wänden – der eigenen Geschichte. In Hue inszenieren sich die Marines wie in einem Tollhaus. Bist Du John Wayne? – Wo ist General Custer? – Und wo bleibt der Show down? 'Stell den Nigger hintern Drücker', sagt ein Schwarzer von sich, stolz, jetzt wirklich, endlich befreit, echt und Ehrenwort, und dann haut wieder ein Stahlmantelgeschoss in einen Body: eine Blutfontäne schießt diagonal übers Bild, schwer und satt, sie scheint stehenzubleiben und das Bild durchzustreichen, nämlich den Film anzuhalten und den Genuss zu intensivieren. Nichts ist bewältigt. 'Full Metal Jacket' hakt das Thema Vietnam nicht ab. Im Gegenteil, Vietnam verfolgt uns in die so heil geglaubten Welten der Popkultur. Bugs Bunny ist das erste Opfer. Wann ist die Mickey Mouse dran? Wann Mick Jagger?
Dieser Text erschien zuerst in: Konkret 11/1987