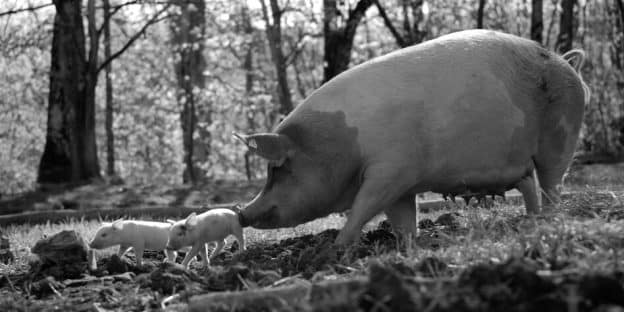„Ich landete auf einem Planeten, den ich als Saturn identifizierte“, erzählte Sun Ra über seine angebliche Entführung durch Außerirdische Mitte der dreißiger Jahre, „und sie wollten mit mir reden. Sie rieten mir, das College zu schmeißen, da es bald in den Schulen drunter und drüber gehen werde. Die ganze Welt würde im Chaos versinken. Ich aber könnte durch meine Musik sprechen und die Welt würde mir zuhören. Das haben sie mir gesagt.“ Es wäre ein Leichtes, Herman Poole Blount einfach als Spinner abzutun, der sich mit einer Alien-Entführungsstory wichtig tun wollte. Allerdings sind diese Phantastereien nur eine Facette einer komplexen Künstlerpersönlichkeit, die unter dem Namen Sun Ra ihr Alien-Dasein in dieser Welt zelebriert hat.
Geboren 1914 in Birmingham, Alabama, hatte sich der Jazz-Pianist Herman Poole Blount 1952 eine Identität als außerirdischer ägyptischer Sonnengott zugelegt. In diese Zeit fiel auch die Gründung seines „Arkestra“, das immer mehr war als lediglich eine begleitende Big Band, worauf bereits die Wortschöpfung im Bandnamen hinweist. Wie in einer Arche hatten die Musiker in der afroamerikanischen Kommune zusammengelebt, ein in exzentrische Kostüme gewandetes Kollektiv von Künstlern, das die Grenze zwischen Kunst und Leben einreißen wollte.
Bis heute tourt das Arkestra, das seit Sun Ras Tod 1993 vom Saxophonisten Marshall Allen geleitet wird, durch die Welt und trägt mit seinem „Cosmic Jazz“ die Weltraumutopie ihres Gründers weiter. Denn um eine Utopie, um den Vorschein einer besseren Welt für die afroamerikanische Bevölkerung, ging es Sun Ra mit seiner Musik, dessen Herkunftsstadt Birmingham Martin Luther King einmal die „Metropole der Rassentrennung“ genannt hat.
Afroamerikanische Utopie
Im Laufe der Vierziger hatte Sun Ra sich in der Jazzszene von Chicago einen Namen erspielt, zunächst mit Swing- und Big-Band-Standards, bald mit neuen, experimentellen Sounds. Diese auf unzähligen Tonträgern – über 100 Alben hat Sun Ra hinterlassen – veröffentlichte Musik ist kaum einzuordnen, zu sehr hat sie sich, wie auch ihr Schöpfer, gegen die Jazz-Konventionen ihrer Zeit gestemmt: mal blubbernd, fiepend, mal klassischer Big-Band-Sound, dann wieder minutenlange Synthesizerexperimente oder spirituelle Texte über das Weltall und die Errettung der Seele. Anders als viele andere afroamerikanische Musiker hat er nicht nach seinen Wurzeln und einer verschütteten Vergangenheit gesucht, stattdessen blickte er nach vorne und vor allem nach oben. Sun Ra hat aus dem traumatischen Motiv der Vergangenheit der Sklaverei, dem Schiff, ein in die Zukunft weisendes, ermutigendes Motiv gemacht: das Raumschiff.

© Rapid Eye Movies
Der britische Kulturwissenschaftler Mark Dery hat diesem Phänomen den Namen Afrofuturismus gegeben. Für den Blick in die Zukunft ist auch eine neue Ästhetik notwendig, in der Wissenschaft und Kunst verschmelzen. Für Sun Ra ist das Raumschiff der Inbegriff dieser neuen Ästhetik, ein Raumschiff, das mit Musik angetrieben wird.
Sun Ra war nicht der Erste, der den space, das Weltall, als Metapher für eine afroamerikanische Utopie benutzt hat, er war jedoch einer derjenigen, die dieses Konzept am konsequentesten umgesetzt haben, weswegen er neben George Clinton und Lee „Scratch“ Perry als Erfinder des Afrofuturismus gilt. Aber die eskapistische Idee, angesichts der Diskriminierung der Schwarzen in USA in Richtung Weltall zu blicken und dort nach einem freieren Leben zu suchen, ist bereits seit dem frühen 20. Jahrhundert durch die afroamerikanische Kulturgeschichte gegeistert.
„Ich bin nicht echt“
Sun Ras Biograph John Szwed erwähnt den baptistischen Priester Reverend A. W. Nix aus Birmingham, Alabama, von dem die Aufnahme „The White Flyer to Heaven“ aus den Zwanzigern datiert, die Ra vermutlich als Kind live erlebt hat: „Höher und höher! Wir werden in den zweiten Himmel übergehen. Den leuchtenden großen Himmel, und sehen die fliegenden Sterne und stürzenden Meteoriten. Und dann lassen wir den Mars und Merkur hinter uns und den Jupiter und die Venus. Und den Saturn und den Uranus, und den Neptun mit seinen vier funkelnden Monden.“
Afroamerikanische Autoren und Musiker wie Duke Ellington, Jean Toomer oder Johnny Griffin haben ebenfalls mit kosmischen Ideen gespielt, bevor Sun Ra sie zu einem Gesamtkunstwerk verwoben hat. „Ich weiß, dass ich nicht von diesem Planeten bin“, hatte etwa der Saxophonist Johnny Griffin erklärt. „Ich muss von irgendwo anders in dieses Universum gekommen sein, weil ich ein totaler Außenseiter bin.“
Ganz ähnlich formuliert es Sun Ra im Film „Space is the Place“ von 1974, der 2019 zum ersten Mal auf Blu-ray erschienen ist. Darin betritt Sun Ra, der sich selbst spielt, begleitet von zwei Wesen mit Masken der ägyptischen Gottheiten Anubis und Horus ein afroamerikanisches Jugendzentrum in Oakland, der Stadt, in der die Black Panther Party gegründet worden war.
Die Wände sind übersät mit Plakaten von Angela Davis, Eldrige Cleaver und anderen afroamerikanischen Ikonen, der Musiker wirkt in seinem bunten Gewand wie ein Fremdkörper im verrauchten Zentrum. Die Jugendlichen lachen ihn aus und fragen, ob er echt sei. „Ich bin nicht echt“, antwortet Sun Ra, „ich bin genau wie ihr. In dieser Gesellschaft existiert ihr nicht. Würdet ihr es, müssten eure Leute nicht für Gleichberechtigung kämpfen. Ihr seid nicht real. Also sind wir beide Mythen. Ich komme zu euch nicht als Realität, sondern ich komme zu euch als der Mythos, weil es das ist, was die Schwarzen sind: Mythen.“
Sexismus, Gewalt und Drogen
In dieser Schlüsselszene des Films wird deutlich, dass es Sun Ra anders als der schwarzen Bürgerrechtsbewegung nicht um eine Integration in die US-amerikanische Gesellschaft ging, da ihm eine tatsächlich verwirklichte Integration utopischer erschien, als im Weltall eine Schwarze Kolonie zu gründen.
„Space Is the Place“ von Regisseur John Coney ist ein wilder Genremix aus Dokumentarfilm, Science-Fiction, biblischer Erlösungsstory und Blaxploitation. Wie auch in anderen Filmen dieses afroamerikanischen Genres werden in „Space Is the Place“ Menschen repräsentiert, die vorher keine Repräsentation im Kino erfahren haben: Schwarze Heldenfiguren. Blaxploitation war, entstanden in den späten sechziger Jahren, eine afroamerikanische Selbstermächtigung im Film, der erzwungenen Passivität der einstigen Sklaverei wurden überzogen gezeichnete schwarze Protagonisten entgegengestellt, Drogenbosse und Gangster, Agenten und Draufgänger, konsequent gefilmt aus einer schwarzen Perspektive. Die Low-Budget-Filme haben mit ihrer Ästhetik, dem Style ihrer meist männlichen, groben und potenten Protagonisten auch den Look von Bewegungen wie der Black Panther Party mit geprägt.

© Rapid Eye Movies
Doch auch hier widersetzt sich Sun Ra allen Erwartungen: Zwar steht der Film in der Tradition des Blaxploitation-Genres, allerdings haben die Drehbuchautoren Sun Ra und Joshua Smith zugleich eine kritischen Auseinandersetzung mit den problematischen Aspekten dieses Genres intendiert. Die von Waffen, Geld und Frauen besessene Figur „The Overseer“, ein klassischer Blaxploitation-Charakter, wird in „Space Is the Place“ zum Antagonisten des positiven Helden Sun Ra. Gerade die Aspekte, die in Blaxploitation-Filmen den Helden definieren, werden hier problematisiert: Sexismus, Gewalt und Drogen.
Schwarze Utopia im Weltall
Sun Ra hat sogar darauf bestanden, dass der Film für das Kino auf eine 60minütige Version gekürzt wird, da ihm das Ergebnis zu sexistisch war, erst nach seinem Tod erschien erstmals die nun vorliegende, in der Tat stellenweise sexistische und misogyne achtzigminütige Schnittfassung des Films.
Vorausgegangen war dem Film das Seminar „The Black Man in the Cosmos“, das Sun Ra 1972 an der University of California in Berkeley abgehalten hatte, sowie die Anfrage von John Coney, einen Dokumentarfilm über Sun Ra und sein Arkestra zu drehen. Dies erklärt den seltsamen Mix aus dokumentarischen Konzertaufnahmen, Space-Mythologie und Spielfilmelementen, denn Sun Ra ließ sich schnell überzeugen, zur Verbreitung seiner Ideen das Genre Film zu nutzen – allerdings in Form eines Science-Fiction- und keines Dokumentarfilms. Jede Einstellung, jede Szene des Films ist mit Bedeutung aufgeladen, ist inszeniert im Sinne von Sun Ras schwarzen Utopia im Weltall.
Nach einem kurzen Vorspiel im Weltall beginnt die Handlung des Films in einem Jazzclub in Chicago 1943, in dem der Pianist Sonny Ray die Begleitmusik zu exotischen Tänzen leichtbekleideter Frauen spielt. Als sein Gegenspieler The Overseer den Laden betritt und den Manager auffordert, dass der Pianist sich gefälligst etwas zurückhalten und stattdessen mehr Mädchen auf die Bühne sollen, eskaliert die Situation: Sonny Rays Pianospiel löst sich immer mehr in Lärm auf, der Gläser zerspringen lässt, Besucher verlassen schreiend den Raum und das Klavier explodiert. Schon hier zeigt sich ein zentraler Konflikt, der im Film ausgetragen wird: Was ist die Rolle von Kunst, von Musik, für die schwarze Community. The Overseer sieht im Jazz reines Entertainment, den Soundtrack zu seiner persönlichen Unterhaltung, während Sonny Ray Musik als Beitrag zur Befreiung von den Zwängen der Gesellschaft, von Alltagsrassismus und Armut begreift.
Gegenentwurf zur kapitalistischen Gesellschaft
The Overseer fordert Sonny Ray zu einem Kartenspiel heraus, dessen Einsatz in der Zukunft der afroamerikanischen Community besteht. In einem surrealen menschenleeren Wüstensetting sitzen sich die beiden gegenüber, und während Sun Ra um die kosmische Emanzipation der Schwarzen spielt, für einen Gegenentwurf zur kapitalistischen US-amerikanischen Gesellschaft, sieht The Overseer die Zukunft in einer schwarzen Emanzipation, die die weißen Macht- und Statussymbole übernimmt; er definiert sich vor allem über Frauen, Waffen, Geld und ausgefallene Autos. Nach diesem ersten Kartenduell springt die Handlung in die damalige Gegenwart, in der Sun Ra unter anderem die beschriebene Begegnung im Community Center hat und danach eine Agentur für Zeitarbeit eröffnet, um unter den Bewerbern diejenigen zu wählen, die mit ihm ins All reisen können.

© Rapid Eye Movies
Die einzigen Weißen, die auftreten, sind zwei sich als Nasa-Mitarbeiter ausgebende FBI-Agenten, die mit Waffengewalt herausfinden sollen, mit welchem Treibstoff Sun Ras Raumschiff angetrieben wird. Nebenbei prügeln sie zwei Prostituierte krankenhausreif und versuchen Sun Ra unter Folter zur Preisgabe der gewünschten Informationen zu bewegen: Gefesselt bekommt er über Kopfhörer Dixieland zu hören. Das weiße Amerika hat zumindest in diesem Film seit dem Ende der Sklaverei kaum Fortschritte gemacht, seine Vertreter strafen mit körperlicher Gewalt und wenden Folter an, kein Wunder, dass Sun Ra nur Afroamerikaner auf sein Raumschiff beamt, als er im Finale des Films, einem Konzert des Arkestra, endlich Richtung All aufbricht. In letzter Sekunde, kurz nach dem Start des Raumschiffs explodiert die Erde.
Erst im All kann Sun Ra einen Ort finden, an dem er kein Alien mehr ist, denn im Weltall, so zeigt eine Szene im Film, sind die Grenzen zwischen Hautfarben, Geschlechtern und anderen trennenden Zuordnungen gefallen, alle Außenseiter, ob Mensch oder Alien, haben ihren Platz gefunden. „Die Musik ist hier anders. Die Vibrationen sind anders. Nicht wie Planet Erde. Planet Erde klingt nach Gewehren, Wut, Frust“, sagt Ra im Weltall. „Hier werden wir eine Kolonie für die Schwarzen errichten.“ Er ist angekommen in der Gegenwart der Zukunft und vielleicht gibt es ja doch noch eine Hoffnung für die Menschheit. Die letzten Worte im Film jedenfalls lauten: „In a far out place, in space, we’ll wait for you.“
Dieser Text erschien zuerst in: Jungle World 33/2019